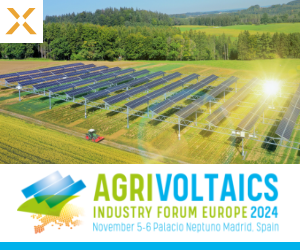26.04.2019
Wie falsche Klimabegriffe eine klare, wirkungsvolle Argumentation erschweren
Eigentlich müsste jedem politisch Engagierten spätestens seit Victor Klemperers 1947 erschienenem Buch „LTI“ klar sein, wie wirkungsvoll das Denken mit bestimmten Begriffen gesteuert wird, und wie wichtig inhaltlich klare sowie wahre Begriffe sind. Der Philologe und Romanistikprofessor, wegen seiner jüdischen Herkunft im Dritten Reich verfolgt und untergetaucht, beschreibt und analysiert dort die Sprache des Dritten Reiches (lat.: Lingua Tertii Imperii, kurz LTI). Begriffe wie Sippe, zackig, jüdischer Krieg etc. prägten Denken und Weltbild im Nationalsozialismus, diskreditierten den politischen Gegner.
Inzwischen ist die Einsicht in die Macht der Sprache und der Worte noch gewachsen. Heute überlegen sich z.B. Unternehmen im Zuge des „Wordings“ ganz genau, wie ihre Botschaften bei Kunden und Öffentlichkeit verstanden werden könnten, ob der Kunde nicht bei einem Produkt „mit einer verbesserten Rezeptur“ zugleich hören würde: „Das alte Produkt, was wir Euch über Jahre verkauft haben, taugte nicht wirklich was.“ Allein die Klimaschutzbewegung und die Klimawissenschaften scheinen, was das Wording in ihrem Bereich anbelangt, etwas – zu – sorglos zu sein.
Wer mit guten Argumenten auf die näherkommende Klimakatastrophe hinweisen und damit auch Gehör finden möchte, sollte sich auch klarer, zutreffender Begriffe bedienen. Die bisher vielfach in der Klimadiskussion verwendeten mögen zwar kuscheliger und weniger schroff sein, aber angesichts des Ernstes der Lage ist damit niemandem wirklich gedient. Klares Denken, Argumentieren und Handeln erfordert auch klare Begriffe. Sonst kann es sein, dass die oft mühsam erarbeiteten wissenschaftlichen Ergebnisse von großen Teilen der Bevölkerung gar nicht wirklich verstanden werden.
Drei Beispiele und entsprechende Gegenvorschläge
26.04.2019
Mieter dürfen Steckdosen-Solargeräte jetzt selbst anmelden
Presseerklärung der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) und Greenpeace Energy:
Nächster Fortschritt für Sonnenenergie vom eigenen Balkon (Sperrfrist: 24.04.19, 10:00 Uhr)
Verbraucher können Steckdosen-Solargeräte zur privaten Stromerzeugung bis zu einer Gesamtleistung von 600 Watt jetzt selbst beim Netzbetreiber anmelden, statt wie bisher über einen Elektroinstallateur. Rechtssicher möglich macht dies eine Neuregelung der Norm VDE-AR-N 4105, die am 27. April 2019 in Kraft tritt. Verabschiedet wurde sie in einem Normierungsverfahren vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN), das in Deutschland die Regeln für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen erarbeitet. "Wir haben uns als Solarverein an diesem mühsamen Prozess beteiligt, um die dezentrale Energieproduktion auch für Mieter und Kleingärtner voranzubringen, die bisher keine eigene Sonnenenergie nutzen konnten", sagt Bernhard Weyres-Borchert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS). Solargeräte die den DGS-Sicherheitsstandard einhalten, liefern Strom schon ab 8 Cent die Kilowattstunde*.
Beim Betrieb von Steckdosen-Solarmodulen ist zu beachten, dass sich der Stromzähler nicht rückwärts dreht. Dies gewährleisten zum Beispiel Stromzähler mit Rücklaufsperre. Die Umrüstung, in der Regel durch die Netzbetreiber, scheiterte bisher jedoch häufig an deren mangelnder Kooperation, da nur ein Verfahren für die Anmeldung von Stromerzeugungsanlagen über Elektriker existierte.
Mit dem Inkrafttreten der neuen VDE-AR-N 4105 sind alle Netzbetreiber verpflichtet, auch die Anmeldung von Steckdosen-Solargeräten bis 600 Watt durch Laien zu akzeptieren. Diverse klimafreundliche Netzbetreiber haben dies bereits in eigene Meldeformulare übersetzt. Für Kunden konservativer Netzbetreiber hat die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) ein mit der neuen Norm konformes Meldeformular entwickelt, das von deren Webseiten heruntergeladen werden kann**.
Mit der neuen Norm werden auch in Deutschland EU-Vorgaben umgesetzt, die in Portugal, Österreich, Luxemburg und der Schweiz längst gängige Praxis sind. Europaweit sind geschätzt mindestens 200.000 solcher Solarmodule bislang problemlos im Einsatz, in Deutschland soll deren Zahl bei 40.000 liegen. Die Sicherheit moderner Steckdosen-Solargeräte wurde durch die DGS, aber auch durch Gutachten renommierter Forschungsinstitute wie des Fraunhofer ISE und diverser Prüfinstitute wiederholt belegt. "Mit der neuen Norm sind wir einen Schritt weiter", sagt Michael Friedrich, Sprecher der Energiegenossenschaft Greenpeace Energy. "Das eigentliche Ziel ist aber eine Regelung für Balkon-Solaranlagen wie in Luxemburg. Dort sind solche Anlagen bis zu einer Leistung von 800 Watt von jeder Anmeldepflicht befreit."*** Schließlich könnten die Anlagen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. "Der Strom wird direkt im eigenen Haushalt erzeugt. Das senkt den CO2-Ausstoß, entlastet die Stromnetze und steigert die Akzeptanz Erneuerbarer Energien", ergänzt Friedrich.
Die Novelle der VDE-AR-N 4105 ist der zweite Erfolg der DGS-Arbeitsgruppe PVplug für die dezentrale und bürgernahe Solarenergie: 2017 erreichte das Team, dass die PV-Module an normale Haushaltsstromkreise angeschlossen werden dürfen, jetzt führten Einsprüche von mehr als 900 Bürger*innen dazu, dass eine zweite zentrale Normungs-Hürde beseitigt wurde.
Weitere Informationen:
*Die DGS-Marktübersicht für Steckdosen-Solargeräte: www.pvplug.de/marktuebersicht
Der DGS-Sicherheitsstandard für Steckdosen-Solargeräte: www.pvplug.de/standard
** Das Meldeverfahren der DGS für Steckdosen-Solargeräte: www.pvplug.de/meldung
*** Luxemburg hat den Europäischen Network Code (Requirements for Generators) der EU in nationales Recht umgesetzt, der dies ermöglicht; in Deutschland fehlt diese Umsetzung noch.
Bildmaterial: www.pvplug.de/mediathek <
Die Pressemeldung zum Download
26.04.2019
Das Karussell im großen Gaspoker dreht sich weiter
Der Kandidat für den Chefposten der EU-Kommission, der CSU-Politiker Manfred Weber, will sich im Falle einer Wahl zum Kommissionspräsidenten für einen Baustopp der umstrittenen Ostseepipeline North Stream 2 einsetzen. Dieses Projekt sei nicht im Interesse der EU, weil es "die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen verstärke", erklärte Weber am Dienstag der polnischen Zeitung Polska Times. Damit vertritt er eine abweichende Meinung gegenüber der Bundesregierung und positioniert sich auf Seiten von US-Präsident Donald Trump. Dieser fordert seit längerem von der Bundesregierung nicht nur vom Bau der Ostseepipeline Abstand zu nehmen, sondern insgesamt russische Erdgasimporte zugunsten amerikanischen Frackinggases zu reduzieren. Um seine Forderungen durchzusetzen, schreckt Trump auch nicht davor zurück, mit höheren Importzöllen auf deutsche Produkte zu drohen.
Passend zu diesem Szenario und Webers Positionierung findet am 2. Mai in Brüssel ein Treffen von Vertretern der EU mit Mitgliedern der US-Administration statt, bei dem es um eine Ausweitung des Fracking-LNG-Handels geht. Dabei dreht es sich genau um diesen typischen Trump-Deal, auf den die EU bereits am 25 Juli 2018 anlässlich des Junker Besuches in Washington eingegangen war. Danach kaufen europäische Importeure amerikanisches Frackinggas und die USA verzichten im Gegenzug auf „Strafzölle“ für die europäische Stahl- und Automobilindustrie. In einer gemeinsamen Erklärung hatte die EU gleichfalls zugesagt, LNG-Infrastrukturprojekte im Wert von mehr als 638 Millionen Euro zu ko-finanzieren.
Damit sollen zusätzlich zu den bereits vorhandenen Kapazitäten bis 2021 weitere 14 Flüssiggas-Infrastrukturprojekte in Europa gebaut werde, die für die Aufnahme von weiterem LNG aus USA bestimmt sind. Dafür hatten die USA zugesagt, alle rechtlichen Beschränkungen für den LNG Export nach Europa aufzuheben. Dieser war erst im Jahr 2016 begonnen worden. Seither hatte die EU Flüssiggaslieferungen mit einem Volumen von 2,8 Milliarden Kubikmeter erhalten. Diese wurden u.a. in den Niederlanden, in Polen und Italien angelandet, wo entsprechende Terminals bereits vorhanden sind. Von dort aus gelangen sie als „Brückentechnologie Erdgas“ auch ins deutsche Gasnetz. Die USA verfügen derzeit über eine Verflüssigung Kapazität von 28 Milliarden Kubikmetern und wollen diese bis zum Jahr 2023 um weitere 80 Milliarden Kubikmeter ausbauen. Damit wollen sie auf den europäischen Markt vorstoßen und die marktbeherrschende Stellung des russischen Erdgases in der EU brechen.
Während für Beobachter klar ist, dass es bei der Kontroverse über russisches Erdgas contra amerikanisches Schiefergas um Trumps Hilfestellung für die US-Mineralölkonzerne geht, die inzwischen vom weltweiten Kampf gegen die Plastik-Verschmutzung der Landschaften und Meere stark gebeutelt sind, schiebt CSU Mann Weber das Argument der „Diversifizierung“ vor. Er sei als Kandidat für den EU-Chefposten allen 28 Mitgliedstaaten der EU verpflichtet. „Wenn man an Europa denke, müsse man an die Unabhängigkeit von russischem Erdgas denken“, so der EVP-Kandidat. An das Plastikproblem und das Klima denkt er weniger. Dass der Kampf gegen die Plastikvermüllung eine hohe Dringlichkeit für Umwelt und Klima hat, ficht ihn nicht an, obwohl die Erzeugung der Kunststoffprodukte in naher Zukunft fast so viel Öl, Gas und Energie verschlingen, wie der weltweite Kraftverkehr.
Klaus Oberzig
Gemeinsame Erklärung (EU/USA): Flüssigerde-Gasimporte (LNG) aus USA um 181 % gestiegen
Die Zehn-Cent-Entscheidung wird zur Gefahr für die Ölmultis, Die Welt, 17.04.2019
26.04.2019
Mieterstrom nur noch im Verborgenen?
Mieterstrom: Entscheidungen von „Beschlusskammern“ der Bundesnetzagentur (BNetzA) setzen knallharte Grenzen. Mieterstrom gilt seit einigen Jahren als Zauberwort bei Projektentwicklern oder Architekten. Das Unternehmen Solarimo spürt sogar den „Rückenwind“ einer neuen EU-Richtlinie: „Konzepte wie das Mieterstrommodell sind europaweit auf dem Vormarsch.“
Es sind ja auch wunderbare Ideen dafür im Umlauf. Ganze Neubausiedlungen sollen über ein eigenes kleines Netz mit Sonnen- und Blockheizkraftwerksstrom elektrisiert und gleich noch die Wärme dazu geliefert werden. Und klingt es nicht toll, wenn die Mieter eines 100-Parteien-Hochhauses mit Strom versorgt werden können, produziert im Keller, an der Fassade oder auf dem Dach des Betonklotzes? Das ist Dezentralität – ein weiteres Zauberwort der Energiewende. Dazu ist diese Energie allemal billiger, als wenn sie via Versorgungsnetz angeliefert wird. Denn die Durchleitungsgebühren der Netzbetreiber entfallen beim Mieterstrom.
Zumindest dann, wenn nicht wie inzwischen spürbar die harte Hand – oder besser: die rigorosen Entscheidungen – der BNetzA Striche durch die schön geplanten Visionen machen. Ein Beispiel, wie die Beschlusskammer 6 der Bonner Bundesbehörde Mieterstrom ausbremsen will, hat dieser Tage die Nürnberger Großkanzlei Rödl & Partner öffentlich gemacht
lesen Sie hier weiter (Text und Kurz-Interview)
26.04.2019
Netzentwicklungsplan und Kritik durch Agora Energiewende
In der vergangenen Woche wurde der zweite Entwurf des Netzentwicklungsplans für das deutsche Stromnetz 2030 von den vier Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) an die Bundesnetzagentur übergeben und veröffentlicht. Er soll nun nochmals öffentlich konsultiert werden, Ziel ist eine Verabschiedung bis zum Jahresende. Das Energiewirtschaftsgesetz fordert die Veröffentlichung eines gemeinsamen Planes (NEP) im Zweijahresrhythmus, der Plan soll aufzeigen, welche Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Übertragungsnetzes für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb aus Sicht der ÜNB erforderlich sind.
Grundlage ist ein Szenarienrahmen, der in allen fünf verschiedenen Szenarien von einem 65%-Anteil des erneuerbaren Stroms im Jahr 2030 ausgeht. Für alle Szenarien ist auch die CO2-Vorgabe des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung enthalten. Die Ergebnisse der Kohlekommission vom Januar sind in zwei der Szenarien gut abgebildet. Besonderes Augenmerk wird auch auf die Netzanbindung der weiteren geplanten Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee gelegt (Steigerung von 5,4 auf 17 bis 20 GW bis 2030). Im NEP 2030 werden nun verschiedene Aktionen vorgestellt, die unter den angesetzten Randbedingungen zur optimalen Arbeitsweise des deutschen Stromnetzes nötig sein sollen. Neben Freileitungsmonitoring, aktiver Leistungssteuerung stehen auch Ausbauten des AC-Netzes sowie große DC-Nord-Süd-Verbindungen auf dem Plan. Auch sind neue Potentiale wie Netzbooster (große Batteriespeicher als Netzstabilisierer) in die Planung eingeflossen. Trotzdem werden als Ausbauziel rund 4.400 km Leitungen genannt, darunter 2.800 km Leitungsverstärkungen und 1.600 Neubau-Kilometer. Das ist jedoch weniger als in der vorherigen Planversion bestimmt wurde, die Kosten belaufen sich aber jetzt geschätzt auf insgesamt 62 Mrd. Euro, das sind 11 Mrd. Euro mehr als bisher angesetzt.
lesen Sie hier weiter
26.04.2019
Die DGS auf der Intersolar Europe (Forum und Stand)
Die Solarisierung unserer Gesellschaft ist ein wesentlicher Baustein einer klimafreundlichen Zukunft. Auf ihrem Forum informiert die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) über die aktuellen Entwicklungen und Rahmenbedingungen. Dabei beleuchten die Vorträge unterschiedlichste Themen: Neben der Energieversorgung werden auch Aspekte der Gebäudevernetzung, der nachhaltigen Mobilität und der Weiterbildung angesprochen. Das DGS-Forum findet am Freitag, 17. Mai von 14.30 bis 16 Uhr in Halle B3, Stand B3.570 statt.
In Deutschland müssen demnächst die ersten PV-Anlagenbetreiber beginnen, von staatlichen Einspeisetarifen auf Eigenverbrauch und Direktvermarktung umzustellen. Beim DGS-Forum wird erläutert, wie die Systeme auch nach dem Auslaufen der Einspeisevergütung wirtschaftlich weiterbetrieben werden können. Ein weiterer Vortrag stellt Hybridkollektoren zur Strom- und Wärmegewinnung vor und bietet eine Einführung in die PVT-Technologie. Um neue Wege bei der Niedertemperatur-Solarthermie wird es in einer weiteren Präsentation gehen.
Das DGS-Forum in der Übersicht
Die DGS ist als Träger der Intersolar Europe wie jedes Jahr auch mit einem Stand auf der Messe vertreten. Sie finden uns dieses Jahr in Halle A3, Stand A3.660. DGS-Mitglieder können auf Anfrage Eintrittskarten für den Besuch der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft erhalten.
26.04.2019
Neue interaktive Broschüre der DGS
In eigener Sache: Die DGS hat zusammen mit JS/Deutschland eine neue interaktive Broschüre erstellen lassen, in der wir uns als Verein vorstellen. Sie ist sowohl für den PC und Computer wie auch für das Smartphone und Tablet optimiert. Zudem gibt es die Broschüre auch in einer gedruckten Variante.
Die DGS gibt darin einen kleinen Einblick in ihre inhaltliche Arbeit, zeigt einen Ausschnitt aus den vielfältigen Dienstleistungen und Serviceangeboten sowie auf die Organisationsstrukturen.
Die interaktive Broschüre finden Sie hier: www.unserebroschuere.de/dgs/WebView.
26.04.2019
Kleiner Medienspiegel
Mehr Power-to-Gas-Projekte in Deutschland: Der Deutsche Verein des Gas und Wasserfaches (DVGW) hat seine Übersichtskarte hat seine Übersichtskarte der Power-to-Gas-Projekte in Deutschland aktualisiert (die Karte als pdf). Darin sind nicht nur die bereits realisierten Anlagen, sondern auch geplante Projekte verzeichnet. 35 Anlagen mit rund 30 MW Gesamtleistung laufen derzeit im Land, 10 Anlagen davon im Forschungsumfeld. Ein Drittel der geplanten Anlagen soll eine Leistung von mehr als 5 MW haben, vorgesehen sind auch 2 Anlagen mit 100 MW (wir berichteten bereits). Aufgrund der Rahmenbedingungen ist die wirtschaftliche Realisierung weiterhin schwierig, so der DVGW, sieht die Technologie jedoch als Chance – technologisch und für die Energiewende: www.zfk.de/energie/gas/artikel/power-to-gas-karte-neun-mal-mehr-leistung-geplant-2019-04-24/
Tag der Erneuerbaren Energien: Am 27. April ist wieder der bundesweite Tag der Erneuerbaren Energien. An diesem Tag zeigen Betreiber, Agenda-Gruppen und Handwerker, wie Erneuerbare Energien in der konkreten Praxis funktionieren. Für die vielen lokalen und regionalen Aktionen ist eine Homepage geschaltet, auf der alle gemeldeten Veranstaltungen eingetragen sind, dort kann direkt gesucht werden mit Ortsnamen/Postleitzahl nach Vorträgen, Führungen usw. Das Programm ist abwechslungsreich und nicht nur technisch: Es werden auch Radtouren zu Anlagen angeboten, Filmabende („Power to Change“) oder Treffen von Elektromobilisten. Jeder Interessierte kann eine interessante Veranstaltung finden: www.energietag.de
Klima-Ehrlichkeit bei Multis erzwungen: Nach einem Bericht von Bloomberg hat eine einflussreiche Gruppe institutioneller Anleger verschiedene Großkonzerne gezwungen, ihre für den Klimawandel relevanten Firmendaten offen zu legen. Die sich „Climate Action 100+“ nennende Investorengruppe verwaltet ein Vermögen von 32 Milliarden USD. Sie will, dass sich Aktionäre besser darüber informieren können, wie sich der Klimawandel auf bestimmte Unternehmen auswirkt bzw. welche Klimaziele die Unternehmen dazu ergreifen; die Unternehmen sollen sich dabei an der Einhaltung des 2°-Klimaziels orientieren. Nach dem Bericht sind bisher u.a. die Ölmultis Royal Dutch Shell und BP Plc sowie der Rohstoff-Handelskonzern Glencore Plc den Forderungen der Anlegergruppe nachgekommen: www.bloomberg.com/news/features/2019-04-11/climate-group-with-32-trillion-pushes-companies-for-transparency
Gotland erhält Schwedens erste Straße für induktives Laden: Die staatlich schwedische Verkehrsbehörde Trafikverket hat dem Konsortium Smart Road Gotland den Auftrag zu Bau der ersten induktiven Ladestraße Schwedens erteilt. Die Straße soll im Zuge eines Private-Public-Partnership (PPP) Projektes auf 1,6 km errichtet werden und zeigen, wie gut das Laden größerer Fahrzeuge wie Busse und Busse während des Fahrens funktioniert. In einem weiteren Ausbauschritt soll dann die Strecke auf 4,1 km ausgebaut werden und den Flughafen der Insel mit der Inselhauptstadt Visby verbinden. Die Technik stammt von dem Konsortialpartner Electreon AB, einer hundertprozentigen Tochter des israelischen Unternehmens Electreon Wireless, einem Spezialisten für induktives Laden: www.prnewswire.co.uk/news-releases/a-first-of-its-kind-dynamic-electric-road-system-will-be-built-in-sweden-842370830.html
100 % Erneuerbare Energie in Albanien: Albanien gehört zu den ärmsten Ländern Europas. Dennoch stammen 100 % des dort erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Weltweit gibt es nur vier Länder, deren Energie zu 100 % erneuerbar ist. Die knapp 8.000 GWh an grünem Strom stammen vor allem aus Wasserkraft. Somit besitzt Albanien einen der geringsten CO2-Ausstöße pro Kopf. Leider wurden andere Erneuerbare Energien wie Photovoltaik oder Wind vernachlässigt. Trotzdem wird den Erneuerbaren Energien in Albanien jetzt schon ein hoher Stellenwert beigemessen, auch müssen in Albanien keine Kohle- oder Atomkraftwerke ersetzt werden: www.energie-bau.at/energie-wirtschaft/3000-laendervergleich-strom-wie-kam-albanien-auf-100-erneuerbare-energie bzw. Artikel aus der SONNENENERGIE.
Straßen frei - Umweltspuren in Düsseldorf für Busse, Fahrräder, Taxen, aber auch für E-Fahrzeuge: Mit Umweltspuren will die Stadt Düsseldorf ein Dieselfahrverbot verhindern. Zunächst sind zwei besonders belastete Straßen der NRW-Landeshauptstadt sind seit Mitte April nur noch für Busse, Fahrräder, Taxen sowie für E-Kraftfahrzeuge und E-Motorräder frei. Auch E-Roller dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung dort fahren. Die Umweltspuren werden zunächst für die Dauer von einem Jahr eingerichtet. Danach findet eine Evaluation statt. Der Grund für die Einrichtung: Der seit 2010 EU-weit geltende NO2-Grenzwert wird in der Landeshauptstadt erheblich überschritten. Die DUH hatte 2015 Klage erhoben, um die gesundheitsschädliche Luftbelastung in Düsseldorf zu senken und die Grenzwerte einzuhalten. Weitere Umweltspuren sind in Prüfung. Und wie zu hören ist, wollen andere Städte dem Modell folgen und ebenfalls Umweltspuren einrichten: www.umweltruf.de//2019_Programm/news/news3.php3?nummer=2423
Update zu Moia-Shuttles in Hamburg: In der vergangenen Woche berichteten wir an dieser Stelle über die neuen elektrischen Moia-Sammeltaxis, die seit neusten in Hamburg unterwegs sind. Der Hersteller VW will damit eine neue Mobilitätslösung einführen und hat mit 100 Fahrzeugen begonnen. Die Flotte sollte später auf 1.000 Fahrzeuge erweitert werden. Die Taxibranche hat schon vor Start dieses Dienstes protestiert und auch juristisch versucht, den Start zu verhindern. In dieser Woche konnten sie nun ein Teilerfolg verbuchen: Das Hamburger Verwaltungsgericht hat in einer Eilentscheidung die Zahl der Moia-Sammeltaxis – entgegen der erteilten Genehmigung der Stadt – auf 200 begrenzt. Moia will nun das Oberlandesgericht anrufen, eine Beschwerde legt auch der Hamburger Senat ein, denn er sieht das Projekt gefährdet, wenn nicht das gesamte Stadtgebiet bedient werden könne. Moia bedauert die Einschränkung und betont, dass der Service mit 15.000 Buchungen in den ersten 10 Tagen sehr erfolgreich angelaufen sei: www.mopo.de/hamburg/schlappe-fuer--moia--sieg-fuer-hamburgs-taxifahrer--gericht-bremst-neuen-fahrdienst-aus-32421414
EU-Wettbewerbshüter bestätigen illegale Absprachen des Autokartells: Nachdem bekannt wurde, dass Daimler illegale Abschalteinrichtungen bei 60.000 Diesel-SUVs des Typs „GLK“ vertuschen wollte, überrascht die defensive Haltung der Bundesregierung und des Verkehrsministers nicht. Inzwischen kommt aber eine ernst zu nehmendere Reaktion von der EU-Kommission. Mit dem jetzt offiziell eingeleiteten Kartellverfahren gegen Daimler, BMW und VW bestätigt die EU den bereits im März 2017 erhobenen Vorwurf der illegalen Kartellabsprache. Konkret wird den drei Konzernen nun die illegale Absprache zu Technologien der Abgasreinigung vorgeworfen. Die großen deutschen Autobauer haben inzwischen zugegeben, sich in Hinterzimmern über die Vermeidung von Benzinpartikelfiltern und minderwertigen Dieselabgas-Katalysatoren abgestimmt zu haben. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert deshalb, dass die Autokonzerne die Abgasanlagen auf eigene Kosten reparieren müssen. Und die Bundesregierung müsse endlich die gesetzlich vorgeschriebenen Geldbußen von den Konzernen eintreiben. www.duh.de
Erste AKW Inbetriebnahmen seit Fukushima: Im slowakischen AKW Mochovce könnte diesen Sommer der erste Reaktor in Europa seit der Atomkatastrophe von Fukushima in Betrieb gehen. Der 1987 begonnene Bau der Blöcke 3 und 4 war im Jahr 1993 abgebrochen und erst 2009 wieder aufgenommen worden, nachdem der staatliche italienische Energiekonzern ENEL eingestiegen war und zwei Milliarden Euro zugesagt hatte. Inzwischen sind die Fertigstellungskosten auf fast sechs Milliarden Euro gestiegen. Die österreichische Regierung kritisiert, dass die Meiler ungeachtet der Modernisierungen von ihrer Grundauslegung her veraltet seien und das Sicherheitsniveau neuer Anlagen nicht erreichten. Gemäß dem Übereinkommen über nukleare Sicherheit von 1994 dürften sie daher nicht in Betrieb gehen. Dies werde Österreich gegenüber der Slowakei und auf EU-Ebene einfordern. Auch Block 4 des AKW Mochovce sowie der Reaktor Neubau im finnischen AKW Olkiluoto sollen noch im Jahr 2019 ans Netz gehen. www.ausgestrahlt.de/mag43web.pdf
Friday Against Nuclear: Zehntausende Schüler*innen gehen jeden Freitag in zahlreichen Städten für wirksame Klimaschutzmaßnahmen auf die Straße. Lobbyist*innen wittern ihre Chance und machen eifrig Werbung für neue AKW und längere Laufzeiten. Die NGO .ausgestrahlt produziert Flyer, die über die Atomrisiken aufklären und kurz und knapp erläutern, warum AKW das ungeeignetste Mittel sind, um den Klimawandel zu bremsen. Zahlreiche Atomkraftgegner*innen verteilen diese auf den Demos. Der sei reißend, die Flyer werden laufend nachgedruckt, so .ausgestrahlt. Dazu gibt es auch ein Transparent mit der Aufschrift „Weg mit Kohle und Atomkraft – ERNEUERBAR ist unser Strom“, Bestellen kann man hier.
Das Redaktionsteam der DGS-News