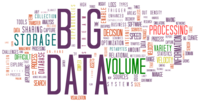22.02.2019
Prognosen – Studien – Prophezeiungen: Eine kritische Sondierung
Von der Antike bis zur Gegenwart – der Mensch hat schon immer gern einen „Blick in die Zukunft“ geworfen. Denn während die Vergangenheit einschätzbar, die Gegenwart gestaltbar ist, bleibt die Zukunft unverfügbar, rätselhaft und damit ein Stück bedrohlich. Was muss ich fürchten, was kann ich erwarten, was darf ich hoffen – dies sind die Kernfragen, die die Prognosen, Studien und Prophezeiungen bezüglich der Zukunft beantworten sollen. Manche Vorhersagen sind allerdings so gestrickt, dass sie weniger diese Fragen beantworten, als dem Adressaten in einer Art selbsterfüllender Prophezeiung suggerieren: „Das musst/sollst Du von der Zukunft glauben“, also eine Deutungshoheit beanspruchen. Denn die Zukunft von heute ist immer zugleich die Gegenwart von morgen, in der es um Macht- und Geldverhältnisse geht – das ist im Bereich der Energie- und Verkehrswende nicht anders.
Betrachtet man die angeführten Studien, so ist ein jeweils eigenes, erkenntnisleitendes Interesse nicht von der Hand zu weisen. Es scheint weniger der Wunsch nach einer analytischen Zukunfts-Sondierung als eher die Setzung einer selbsterfüllenden Prophezeiung im Vordergrund zu stehen. Dass man das Thema Prognosen auch ganz anders angehen kann, zeigt auf sehr eindrückliche Weise die deutsche Bundesregierung, der für so etwas natürlich staatliche Mittel zur Verfügung stehen. Diese hatte 2010 den „Nationalen Aktionsplan für Erneuerbare Energie gemäß der Richtlinie 2009/28/EG der Bundesrepublik Deutschland“ vorgelegt, der die künftige Entwicklung bis 2020 beschreibt. Dieser Aktionsplan enthält nicht nur Mindestvorgaben wie „Im Jahr 2020 sollen mindestens 30% Erneuerbare Energien im Strombereich ... erreicht werden.“, sondern er prognostiziert auch die Ausbau-Pfade bis 2020. Und dort steht bei erneuerbare Energiequellen - Elektrizität für 2020: 38,6%! Das ist im Vergleich zu anderen Prognosen eine hervorragende Präzision und Leistung. "Chapeau!" Dass man von Seiten der Merkelschen Bundesregierungen zum Erreichen dieser Zielgenauigkeit mit atmenden Deckeln, Strompreisbremsen und wachsenden Mindestabständen von Windkraftanlagen operieren musste, sowie die deutsche Solarindustrie – selbstverständlich ganz marktwirtschaftlich – von staatlich geförderten chinesischen Solarkonzernen ausschalten ließ – Schwamm drüber! Hauptsache, die eigenen Prognosen stimmen!! Un-Wohl dem Lande, das solch‘ prophetische Regierungen hat.
Hierzu einige Beispiele
22.02.2019
Die sich wandelnde Rolle der Versorger
Nachdem der Ökostromanbieter Lichtblick angesichts der wachsenden Marktmacht von Eon davor gewarnt hatte, ein Big-Data Monopol sei im Entstehen begriffen, gerät die Rolle der Versorger als digitale Dienstleister, lange nach der Verabschiedung des Digitalisierungsgesetzes, ins Blickfeld der Diskussion. Die These, aus einem Energieversorger, der 80% der Endkundenanschlüsse kontrolliert, könnte einen Moloch ähnlich wie Amazon entstehen, basiert auf der Erkenntnis, wie dynamisch solche Big-Data Plattformen sind und was daraus alles entstehen kann. Mit Gas, Wasser, Strom und Breitband lassen sich digitale Dienste und Modelle entwickeln und abrechnen, die vor kurzem noch undenkbar erschienen. Vom zusätzlichen Verlegen bzw. Betreiben von Glasfaserkabeln bis hin zu Telefonie und Internet, ein Energieversorger der im Netz aktive Technik einsetzt, erweitert oder einkauft, kann recht schnell zum Telekommunikationsanbieter und Mobilitätsdienstleister mutieren. Dass damit längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein dürfte, zeigt das stürmische Wachstum von Amazon, Google oder den Chinesen von Alibaba, dessen Zeuge wir gegenwärtig sind.
Der Hintergrund dieser Entwicklung besteht darin, dass in Zeiten einer sich entwickelnden Null-Grenzkosten-Gesellschaft mit der reinen und ausschließlichen Energieerzeugung kein Geld mehr zu machen sein dürfte. Man könnte es noch extremer ausdrücken: woher und vom wem die Energie erzeugt und geliefert wird, wird unerheblich sein. Das haben die Energiekonzerne verstanden und bauen ihre Geschäftsmodelle strategisch um. Energiedienstleistungen im und rund um das Netz, also die Fähigkeit zum Fluktuationsausgleich - apostrophiert als umfassende Fürsorge und Versorgungssicherheit - werden als lukratives Kerngeschäftsfeld eingerichtet. Und wenn einmal dieser enorme Investitionsaufwand in Netzen, Leistungselektronik und Big-Data Plattform getätigt ist, muss für einen angemessenen Return of Investment und vor allem für permanentes Wachstum gesorgt werden. Das ist für finanzstarke Energiekonzerne, die auch mit Regierung und Politik gut vernetzt sind, kein Problem. Je größer das Netz desto leichter lässt es sich vermarkten und desto mehr Umsatz wird generiert. Das Digitalisierungsgesetz hat die passende Grundlage geschaffen.
lesen Sie hier weiter
22.02.2019
Großtechnisch Gas aus Strom gewinnen: Neue PtG-Projekte
Im Moment gewinnt man als Beobachter der Energiewende den Eindruck, dass die Power-To-Gas-Branche im Aufwind ist. Selten wurden in so kurzem Abstand neue (und größere) Projekte vorgestellt. Deshalb sollen an dieser Stelle drei aktuelle Ankündigungen beschrieben werden.
Das Problem all dieser Projekte: So euphorisch die Projekte dargestellt werden und die technischen Daten auch zur Energiewende passen, so sehr betonen die beteiligten Unternehmen aber auch unisono, dass für die Umsetzung der Projekte noch Rahmenbedingungen geändert werden müssen, um eine Realisierungschance herzustellen. Im aktuellen Rahmen sind sie wirtschaftlich nicht umsetzbar.
Der Hintergrund der Projekte ist immer der gleiche: Überschüssiger Strom, der zum Beispiel aus Windkraft erzeugt wird, soll in einer Power-To-Gas-Anlage (PtG) in Gas (Wasserstoff oder Methan) umgewandelt werden. Das kann dann in der bestehenden Infrastruktur gut verteilt und gespeichert werden. Die Gasversorgung wird grüner und leistet auch einen Betrag zur CO2- und Energiewende-Diskussion. Gleichzeitig bietet die Speicherung als Gas auch den Vorteil gegenüber Stromspeichern, dass die Energie hier auch monatelang (z.B. auch PV-Strom vom Sommer in den Winter) aufgehoben werden kann. „Um 80 und mehr Prozent Erneuerbare Energien zu nutzen, brauchen wir nicht nur die passende Stromnetz-Infrastruktur, sondern auch alternative Transportlösungen und leistungsfähige Speicher wie sie das Gasnetz und Power-To-Gas bieten“, so fasst es Manon van Beek, Vorstandsvorsitzender der TenneT, in einer aktuellen Pressemeldung zusammen.
Zu den einzelnen Projekten
22.02.2019
Netzausbaubeschleunigungsgesetz NABEG: Parteiengeplänkel ohne Konsens
Was kommt nach dem NABEG, dem 2011 vom Bundestag beschlossenen Netz-Ausbau-Beschleunigungsgesetz? Natürlich das NABEG-Beschleunigungsgesetz. Am Mittwoch dieser Woche wurden Sachverständige im Bundestags-(BT-)Ausschuss für Wirtschaft und Energie angehört. „Schnellerer Energieleitungsausbau stößt bei Experten auf Zustimmung“: Unter dieser Überschrift fasste die Buntdestags-Pressestelle die zwei Stunden-Veranstaltung zusammen.
Das musste all jenen schleierhaft vorkommen, die die Befragung verfolgt hatten. Wollten sich die BT-Mitarbeiter möglicherweise nicht mit der Mehrheitsfraktion von CDU und CSU anlegen? Hatte doch CDU-Abgeordneter und Reserveoffizier Joachim Pfeiffer aus Waiblingen schon vor seiner ersten Frage klargestellt: „Es liegt ein gutes Gesetz vor. Wir wollen die Rechtswege beschleunigen.“ Und seine FraktionskollegInnen schlugen mit ihren Fragen in dieselbe Kerbe. Das bleibt natürlich haften.
Zu Bundestags-Expertenbefragungen muss man aber wissen: Sie verlaufen nach den Kräfteverhältnissen im Parlament. Weshalb von 19 Fragerunden mit je vier Minuten Antworten die größte Fraktion auch fast die Hälfte der Fragen stellen durfte. Zudem: Sie stellte drei, die SPD zwei Sachverständige. Die kleineren Fraktionen hatten jeweils nur einen Menschen mit Fachkenntnis berufen können.
lesen Sie hier weiter
22.02.2019
350 kW werden geboten
Die niederländische Fastned hat sich zum Ziel gesetzt, ein europaweites Netzwerk von Schnellladestationen aufzubauen. Eine erste Ultra-Schnellladestation wurde Ende 2018 in Limburg an der A3 errichtet. Dort wurde ein 175 kW-Ladegerät montiert, das für eine extrem rasche Aufladung von Elektrofahrzeugen sorgt. Die zweite derartige Anlage folgte in Paderborn an der A33, auch dort wurde – wie beim aktuellen Projekt an der A5 in Herbolzheim – ein auffälliges gelbes Dach mit durchscheinenden Solarzellen gebaut.
Doch während in Paderborn auch 175 kW die maximale Ladeleistung sind, wurde bei den neuen Anlagen in Hildesheim und Herbolzheim dieser Wert noch weiter erhöht: Neben einer Ladung mit 43 kW (AC) oder 50 kW (mit CCS oder CHAdeMO) ist ein Ultra-Lader mit einer maximalen CCS-Ladeleistung von 350 kW vorhanden. Von dieser Leistung kann das Solardach natürlich selbst bei bestem Sonnenschein nur einen Bruchteil von einigen Kilowatt bereitstellen, für den Rest bezieht das Unternehmen nach eigenen Angaben Ökostrom aus Sonne und Wind. Deutlich wird auch, dass mit steigender Leistung auch ein Solardach und die Ladesäulen nicht mehr ausreichen: Neben der Ladestation ist eine Menge Technik in Form einer Trafostation und weiterer elektrotechnischer Installation aufgebaut. Das Dach ist so hoch, dass auch eine Betankung von Elektro-LKW oder anderen Schwerlastfahrzeugen möglich ist – diese Zukunftsoption ist offen.
lesen Sie hier weiter
22.02.2019
#FridaysForFuture: Schüler kämpfen für Klimaschutz
(KlimaLounge) In aller Welt streiken und demonstrieren immer mehr Schüler dafür, dass beim Klimaschutz endlich ausreichend gehandelt wird. Vor einem halben Jahr begann die damals 15-jährige Schwedin Greta Thunberg (hier im Video-Interview), sich jeden Freitag vor das Parlament in Stockholm zu setzen statt in die Schule zu gehen. Sie fordert, dass das Pariser Klimaabkommen kein Stück geduldiges Papier bleibt, sondern dass die Ziele auch tatsächlich umgesetzt werden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Offenbar sprach sie damit vielen Schülern weltweit aus dem Herzen, denn immer mehr tun es ihr gleich und protestieren an Freitagen – so auch heute in vielen Städten, unter anderem auch in Potsdam.
Stefan Rahmstorf war von den Potsdamer Schülern eingeladen worden, auf der Demonstration vor dem Landtag ein paar Worte zu sagen. Diese Einladung hat er gerne angenommen.
Lesen Sie hier den (mit weiterführenden Links versehenen) Redetext von Stefan Rahmstorf
22.02.2019
Urban Solar Decathlon: Internationaler Innovationswettbewerb kommt nach Wuppertal

Studierende von Hochschulen aus der ganzen Welt beteiligen sich seit Jahren an dem als Solar Decathlon bekannten Gebäude-Energiewettbewerb. Deutschland setzt sich seit langem für eine inhaltliche Weiterentwicklung des Wettbewerbsformats ein und leitet dazu auch eine Arbeitsgruppe im Rahmen der Internationalen Energie Agentur. Vor diesem Hintergrund hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im vergangenen Jahr einen Ideenwettbewerb im Rahmen seiner Förderinitiative „EnEff.Gebäude.2050“ ausgelobt und Vorschläge für einen Gebäude-Energiewettbewerb in Deutschland erhalten. Das Team aus Bergischer Universität Wuppertal, Stadt Wuppertal, Wuppertal Institut, Stadtwerke, der Neuen Effizienz und der Initiative Utopiastadt wurde dabei mit seinem Vorschlag „Solar Decathlon goes Urban“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Dies war die Grundlage für die deutsche Bewerbung als Austragungsort des nächsten Solar Decathlon beim europäischen „Call for Cities“ durch die Energy Endeavour Foundation.
„2021 findet der Solar Decathlon Europe erstmals in Deutschland statt und zwar in Wuppertal, mitten in der Stadt. Er thematisiert die Energiewende im Quartier und damit die Weiterentwicklung des urbanen Gebäudebestands. Genau dieser Bestand ist es, der den Schwerpunkt der architektonischen und bauwirtschaftlichen Tätigkeiten in Deutschland und Europa ausmacht. Umbauen, Anbauen, Aufstocken und Baulücken schließen sind dabei die zentralen architektonischen Aufgaben – Ressourceneffizienz, Suffizienz, Klimaschutz und recyclinggerechtes Bauen zentrale Themen“, betont Dr.-Ing. Katharina Simon von der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen an der Bergischen Universität.
Noch im März wird der internationale Aufruf zur Bewerbung von Hochschulteams veröffentlicht. Sie können sich dann bis zum Herbst bewerben. Vor dem Jahreswechsel werden die Teams feststehen, die im September 2021 im Finale antreten. Die Teams haben dann fast zwei Jahre Zeit, ihre Häuser zu entwerfen, zu planen und vor Ort in Wuppertal zu bauen.
Website Solar Decathlon
22.02.2019
BIPV-Forum im Kloster Banz: Mehr Power aus der Mauer

Die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) erfährt eine dynamische Entwicklung. Immer mehr Pilotprojekte, technische Innovationen und nicht zuletzt eine wachsende Akzeptanz bei Bauherren und Architekten treiben den Markt voran. Heute sind BIPV-Anlagen selbst in denkmalgeschützten Gebäuden gestalterisch diskret integriert und bekannte Neubauprojekte wie das Freiburger Rathaus bringen das Thema in den Fokus von innovativen Architekten, Ingenieuren und Investoren.
„Der Wunsch vieler Bauherren nach einer hohen Eigenbedarfsdeckung spricht zudem für die integrierte Photovoltaiklösung in einem energetischen Gesamtkonzept“, betont Wolfgang Willkomm. Er ist der fachliche Leiter des Forums und Professor für Baukonstruktion und Baustofftechnologie an der HafenCity Universität (HCU) in Hamburg.
Dünnschichtmodule und organische Solarfolien könnten bei der BIPV künftig stärker zum Zuge kommen. Teiltransparente Module geben Planern neue ästhetische Gestaltungsräume. Der Veranstalter Conexio lädt Architekten, Bau- und Solarindustrie am 18. und 19. März 2019 nach Bad Staffelstein zum alljährlichen Forum Bauwerkintegrierte Photovoltaik ein. Erstmals wird die Tagung nicht nur einen, sondern zwei Tage dauern.
Weitere Informationen und Tickets erhalten Sie unter: www.bipv-forum.de
Anmerkung: Die DGS ist Mitveranstalter, die SONNENENERGIE Medienpartner der Veranstaltung. DGS-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 10%. Sie erhalten auf Anfrage in der DGS-Geschäftsstelle einen Rabattcode, den Sie dann in die Teilnehmer-Anmeldemaske unter Aktionscode eingeben können.
22.02.2019
34. PV-Symposium 2019: Qualität rechnet sich langfristig

Was bedeutet das Energiesammelgesetz für den deutschen Solarmarkt? Wie geht es weiter mit den Mieterstromprojekten? Wie kann die Qualität bei Heimspeichern bewertet werden? Antworten darauf geben Experten auf dem PV-Symposium vom 19. bis 21. März 2019 in Bad Staffelstein.
Das Energiesammelgesetz verunsichert derzeit die Photovoltaikbranche hierzulande. Dennoch sind die Aussichten europaweit sehr gut: 2018 hat der solare Zubau gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rund 20 Prozent zugelegt. „Aktuell fehlen aber 15 Gigawatt Photovoltaikleistung für eine ausgeglichene Stromerzeugung zwischen Tag und Nacht sowie zwischen Sommer und Winter. Diesen Zubau gilt es nachzuholen“, fordert Bruno Burger vom Fraunhofer ISE aus Freiburg, fachlicher Leiter des diesjährigen PV-Symposiums. „Um die Klimaziele der Bundesregierung für 2030 zu erreichen und die bis dahin vom Netz gehenden Kernkraftwerke zu ersetzen, müssen mindestens zehn Gigawatt Photovoltaik und Windenergie pro Jahr neu gebaut werden.“
Wie ein stärkerer Zubau vorangetrieben und zugleich ins bestehende System integriert werden kann, diskutieren Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Forschungsinstituten auf dem 34. PV-Symposium 2019. Der letzte Veranstaltungstag steht ganz im Zeichen der Qualität – und kann separat gebucht werden.
Sichern Sie sich Ihre Tickets unter: www.pv-symposium.de
Anmerkung: Die DGS ist Mitveranstalter, die SONNENENERGIE Medienpartner der Veranstaltung. DGS-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 10%. Sie erhalten auf Anfrage in der DGS-Geschäftsstelle einen Rabattcode, den Sie dann in die Teilnehmer-Anmeldemaske unter Aktionscode eingeben können.
22.02.2019
Kleiner Medienspiegel
Klimaschutzgesetz vorerst auf Eis gelegt: Die Regierungsparteien haben vergangene Woche im Koalitionsausschuss über den Klimaschutz gesprochen - mit ernüchterndem Ergebnis. Es habe für zu viel Sprengstoff gesorgt, heißt es aus Unionskreisen. Bereits Ende 2018 wurde im SPD-geführten Umweltministerium ein Referentenentwurf ausgearbeitet, welcher nun im Kanzleramt liegt. Das Klimaschutzgesetz soll die Reduktionsziele der einzelnen Sektoren festlegen und wird auch von der Industrie zunehmend stärker gefordert. So sollen die von der Bundesregierung mehrfach bestätigten Klimaziele erreicht werden. Der aktuelle Klimaschutzbericht hingegen prognostiziert eine deutliche Verfehlung der 2020-Ziele. Wie wenig Deutschland beim Klimaschutz vorankommt, zeigen auch die nicht erfolgte Einsetzung einer Gebäudekommission und die Ankündigung durch BMWi-Staatssekretär Feicht, die CO2-Bepreisung in die nächste Legislaturperiode zu verschieben. Das im Koalitionsvertrag verankerte Gesetz müsse in diesem Jahr verabschiedet werden, fordert dagegen die Klimaallianz Deutschland: www.sueddeutsche.de/politik/klima-klimaschutz-gesetz-erderwaermung-spd-cdu-regierung-1.4332637
Dranbleiben am Ausbau: Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) fordert in einer aktuellen Meldung vom Mittwoch auf, die Erneuerbaren Energien ambitioniert auszubauen. Es sei zudem deutlich sinnvoller, in klimafreundliche Technologien zu investieren und damit den Standort zukunftsfit zu machen, als Milliarden an Strafzahlungen aufgrund verfehlter Klimaschutzziele zu zahlen, so die Präsidentin des BEE, Dr. Simone Peter. Das Klimaschutzgesetz dürfe nicht weiter vertagt werden, die CO2-Bepreisung müsse in Diskussion bleiben und auch das Gebäudeenergiegesetz müsse zügig vorgelegt und verabschiedet werden: www.bee-ev.de/home/presse/mitteilungen/detailansicht/klimaschutzluecke-mit-erneuerbaren-energien-schliessen/
Bremsung für Ladesäulen: Am 15.2. beschloss der Bundesrat in einer Plenarsitzung eine Änderung der Niederspannungsanschlussverordnung. Dort ist jetzt das Verfahren geregelt, mit dem ein Kunde bei seinem Netzbetreiber die Installation einer Ladesäule für ein Elektroauto anmeldet. Ein Rückschlag für die Elektromobilität: Zukünftig darf der Netzbetreiber darüber entscheiden, ob größere Ladeleistungen über 12 kVA (nicht die kleine Wallbox in der Garage) gebaut werden können oder nicht. Auf einen Installationswunsch hin hat der Netzbetreiber zwei Monate (!) Zeit zu antworten, erfolgt keine Antwort oder kommt eine Ablehnung, hat der Interessent mit der Neuregelung keine Handhabe, die Installation trotzdem realisieren zu können. Ein Netzbetreiber könnte also den Ausbau im schlimmsten Fall zukünftig völlig ausbremsen: edison.handelsblatt.com/e-hub/ladesaeulen-warum-bremst-der-bund-so-unnoetig/24006960.html?social=twitter
Milch und Brot fahren mit LNG: In Norddeutschland werden zukünftig 100 Lastwagen einer Spedition, die unter anderem auch Norma und netto beliefern, mit LNG betrieben. Die Spedition hat dafür neue Fahrzeuge von Scania bestellt, das Berliner Unternehmen Liquind baut für den Betrieb an den zwei geplanten Standorten der Flotte jeweils eine LNG-Tankstelle. Liquind hat das Ziel, eine europaweite flächige Verteilinfrastruktur für flüssiges Gas aufzubauen, um Schadstoffausstoß im Schwerlastverkehr zu reduzieren. Weitere Standorte (Berlin, Hamburg, Frankfurt) werden ebenfalls entwickelt, zusätzlich auch an verschiedenen wichtigen Wasserstraßen. Das flüssige Gas soll von derzeitigem Erdgas auf immer größere Anteile von grünem Gas umgestellt werden www.zfk.de/mobilitaet/neue-kraftstoffe/artikel/liquind-baut-lng-tankstellen-netz-aus-2019-02-18/
Beratungsstelle für bauwerkintegrierte PV: Eine nationale Beratungsstelle für bauwerkintegrierte Photovoltaik (BAIP) errichtet des Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) in diesem Frühjahr in Berlin-Adlershof - in unmittelbarer Nachbarschaft zu PV-Forschung-Instituten und Technologieunternehmen. Ziel des auf vier Jahre angelegten Projekts ist es, für Architekten, Bauherren, Investoren, Planern und Stadtentwicklern eine produktneutrale Anlauf- und Beratungsstelle zu bieten, und so das Thema der Energiegewinnung durch die Gebäudehülle weiter zu verbreiten. Denn um den Gebäudebestand bis 2050 praktisch klimaneutral zu bekommen, reichen PV-Module auf Dachflächen nicht aus, zumal die Dachflächen weitgehend gleichbleiben, der umbaute Raum aber durch Aufstockungen und höhere Bauweise zunimmt. Für ihr Projekt hat die BAIP u.a. die Bundesarchitektenkammer, das Reiner Lemoine Institut, sowie die Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft gewonnen: www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=20321
Kein Friede in den Dörfern des rheinischen Reviers: Der Konsens in der Kohlekommission sollte den Streit um den Hambacher Forst beenden. Aber RWE reißt weiter Dörfer ab und Aktivisten besetzen Bagger. Seit der Veröffentlichung des Abschlussberichtes läuft ein Deutungsstreit. Um möglichst alle Teilnehmenden zur Unterzeichnung zu bewegen, hatte man viele Stellen schwammig formuliert. So heißt es, der Erhalt des Waldes am Tagebau Hambach sei „wünschenswert“, und mit den Dorfbewohnern am Tagebau Garzweiler solle gesprochen werden. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat errechnet, dass sowohl der Wald als auch die Dörfer erhalten bleiben könnten und die bereits erschlossenen Tagebauflächen bis zum vereinbarten Ausstieg genug Kohle für die Kraftwerke liefern würden. Doch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) spielt den Wald und die Dörfer gegeneinander aus. „Wenn ein Gebiet herausgenommen wird, wird der Druck auf andere Gebiete höher“, meint er – und fügt hinzu, zu den Dörfern gebe es im Bericht der Kommission „nur eine allgemeine Beschreibung, aber keine Zielvorgabe“. Und RWE schafft derweil im Garzweiler Bereich mit weiteren Abbaggerungen neue Fakten: www.taz.de/!5570955/
Atomkraft in Japan: Acht Jahre nach dem Super-GAU von Fukushima ist die Mehrheit der Bevölkerung für einen Ausstieg, kann sich aber gegen den politisch-industriellen Komplex nicht durchsetzen. Von den 54 Reaktoren sind inzwischen neun wieder am Netz, wie die Antiatomorganisation „ausgestrahlt“ meldet. Auch wenn die Zahl der Atomkraftgegner nach den traumatischen Erfahrungen des 11. März 2011 stetig wächst, plant die Regierung des atomfreundlichen Premierministers Shinzo Abe die Zahl der AKW bis 2030 wieder auf 30 zu erhöhen. Das Hauptaugenmerk seiner Politik liegt neben der Atomkraft auf einer schnellen Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft in Verbindung mit erneuerbaren Energien. Diese, so der neueste Plan, soll bis zum Jahr 2040 mehr als die Hälfte des Stroms liefern. Allerdings mussten Abe und das industrielle Establishment erst einmal Rückschläge einstecken. Im vergangenen Jahr ging die Reaktorsparte von Toshiba pleite. Auch der Konkurrent Hitachi meldet Zweifel an der wirtschaftlichen Zukunft der Atomkraft an und verlangt finanzielle Garantien, bevor weitere Projekte in Planung gehen. Schwach entwickelt ist in Japan die Windkraft, so wird kaum in Offshore-Windparks investiert. Atomkraftgegner plädieren für Solar und verweisen darauf, dass die letzten acht Jahre bewiesen hätten, dass es ohne Atom geht. Tatsächlich kamen 2017 nur rund drei Prozent des Stroms aus den Meilern: www.ausgestrahlt.de/mitmachen/jahrestag-fukushima/
US-Kernkraftwerke für Saudi-Arabien: Mehrere US-Firmen, die Präsident Trump nahe stehen, planen Nukleartechnologie an Saudi-Arabien zu liefern, wie die TAZ am 20.2.2019 meldete. Ein Bericht des Repräsentantenhauses, der sich weitgehend auf die Informationen von „Whistleblowern“ stützt, spricht von „schwerwiegenden Bedenken und Sorgen vor einem nuklearen Wettrüsten in der Region. Den Informationen zufolge, handelte es sich um den geplanten Bau von „Dutzenden Kernkraftwerken“. Wie das BBC-Nachrichtenportal am Mittwoch berichtete, leiteten mehrere Abgeordnete der Demokraten eine Untersuchung ein. Der Bericht nennt mehrere Unternehmen, darunter die IP3 International, die von Ex-Militärs und Ex-Sicherheitsberatern offenbar zu dem Zweck gegründet wurde, mit den Saudis ins Kernkraftgeschäft zu kommen. Mit im Boot sei auch die Flynn Intel Group, ein Beratungsunternehmen des früheren Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn. Bereits im Januar 2017 musste Flynn, nachdem er Verbindungen ins Ausland verschwiegen hatte, von seinem Amt zurücktreten. Experten vermuten, dass diese Geschäfte, zusammen mit dem Ausstieg aus dem Iran-Abkommen, seit langem Teil des von Trump angekündigten „Jahrhunderteplans“ für einen Nahost-Frieden sind: www.taz.de/!5575034/
Lex Greenpeace in Sachsen: Nach einem Bericht von Netzpolitik.org hat die sächsische Staatsregierung das auf eine EU-Richtlinie zurückgehende Landes-Umweltinformationsgesetz zum 1. Januar 2019 so geändert, dass der Landesrechnungshof nicht mehr auskunftspflichtig ist. Hintergrund ist der Versuch der Umweltorganisation Greenpeace, einen Sonderbericht des Sächsischen Rechnungshofs einzusehen, in dem es angeblich um durch die Staatsregierung verursachte Milliardenrisiken für Steuerzahler bei Sicherheitsleistungen im Bergrecht geht: netzpolitik.org/2019/lex-greenpeace-sachsen-aendert-heimlich-gesetz-um-gutachten-geheimzuhalten/
Klaus Oberzig/ Jörg Sutter/ Götz Warnke