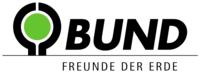13.10.2017
Wählerwille ist ein dehnbarer Begriff
Nachdem die ersten Wogen der Bundestagswahl abgeebbt sind, sollten wir uns den bedeutenden Dingen zuwenden. Schließlich ist es weniger entscheidend, wer die Regierung bildet, als vielmehr was eine künftige Regierung tun wird. Das klingt jetzt vermutlich ein wenig einfältig, schließlich stehen Parteien ja für Ziele und Werte. Aber ob das wirklich noch der Fall ist, oder es sich nur um eine romantische Duselei handelt, sollte mehr denn je kritisch hinterfragt werden. Zuletzt waren die parteipolitischen Überzeugungen früherer Jahre oft nur noch schwer auszumachen, zumindest wenn man so manche Äußerung genauer analysiert. Das gilt auch für Wahlprogramme. Dort wird selten konkret formuliert, von einstigen Dogmen ist nichts mehr übrig. Oftmals sind es nur noch Etiketten, mit denen sich Parteien schmücken. Das Ziel von Parteistrategen wie einzelnen Politikern scheint zu sein, die eigenen Inhalte so verwaschen wie nur möglich darzustellen, um sich alle Türen offen zu halten. Für den Wähler ist es deshalb nicht leicht, seinen Wunsch – weniger seinen Willen – zu äußern. Denn letztlich fördert erst das Wahlergebnis die zur Verhandlung stehenden Prinzipien zu Tage.
Unpolitisch mit System
Zurück zum Tagesgeschehen: Es ist schon kurios, wie viel „Verständnis“ aufgebracht wird, wenn, seit dem unmittelbar nach der Wahlprognose vollzogenen Gang der SPD in die Opposition, bis heute keine offiziellen Gesprächen zwischen vermeintlichen Koalitionären zustande gekommen sind. Das zunächst die Landtagswahl in Niedersachsen abgewartet werden soll, leuchtet wenig ein. Was hat diese mit Koalitionsverhandlungen zu tun? Oder geht es darum, wie schon während des gesamten Bundestagswahlkampfs zu beobachten, keinesfalls öffentlich über nicht genehme Inhalte zu sprechen? Weil alles, was man sagt, dann gegen einen verwendet werden könnte? Der meist nur an die Bundeskanzlerin adressierte Vorwurf des unpolitischen Wahlkampfs trifft im Übrigen nicht nur auf die CDU zu. Auch wenn diese offensichtlich den Takt bestimmt, hätten sich andere diesem Rhythmus nicht unterwerfen müssen. Der Eindruck wird zur Gewissheit, wenn man sieht, wie Themen von den Parteien vorgegeben werden. Alles andere ist nicht gewünscht und wird totgeschwiegen. Stattdessen wird dann auch in einer Art Vertriebsrhetorik formuliert: Parteien wollen uns Bürger abholen. Aber wollen wir das überhaupt?
lesen Sie hier weiter
13.10.2017
Erdgas statt Kohle – aber keine Dekarbonisierung
Will man sich in Sachen Energie- und Klimapolitik einer zukünftigen Regierungskoalition, wie auch immer sie gestrickt sein möge, ein Bild machen, lohnt der Blick auf das Rot-Rot-Grüne Regierungsbündnis in Berlin. Das ist zwar nicht Jamaika, aber die Grünen versuchen hier seit rund einem Jahr Energiepolitik zu „machen“. Als Bundesland verfügt die Hauptstadt über keine Windkraft und wenige Solarparks. Auch auf den Dächern sind Solarkollektoren und –module eine Seltenheit. In Berlin stammt die Wärme zu 98% aus fossilen Quellen. Der Gebäudebereich verursacht zurzeit rund 47% der Berliner CO2-Emissionen. Die Zahlen unterstreichen die Notwendigkeit einer Wärmewende in der Stadt. Ohne einen Umbau der Wärmeversorgung wird es keine Energiewende in Berlin geben, resümierte bereits die Enquete-Kommission „Neue Energie für Berlin“ des Berliner Abgeordnetenhauses von 2015, also noch zu Zeiten der Rot-Schwarzen Koalition im Land Berlin. Das ebenfalls in 2015 erarbeitete Berliner Energie und Klimaschutzprogramm (BEK) benennt dazu Handlungsfelder für die zukünftige Transformation des Wärmesektors. Das Energiewendegesetz des Landes Berlin verankert gesetzlich die Senkung der Treibhausgasemissionen um 85% bis zum Jahr 2050 auf Basis von 1990. Die Rot-Rot-Grüne Landesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag von 2016 ausdrücklich zur Umsetzung des BEK und der Enquete-Ergebnisse verpflichtet und zum Kohleausstieg bis 2030 bekannt.
Vor diesem Hintergrund fanden am 10. Oktober in Berlin zwei Veranstaltungen statt, die ein beredtes Zeugnis über den Stand der Diskussion zum Thema Wärmewende lieferten. Es handelte sich zum einen um einen „Strategieworkshop Wärmewende Berlin 2030“ von der Böll-Stiftung und der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und auf der anderen Seite um eine Veranstaltung der Deutschen Energieagentur (Dena), auf der sie das „Zwischenfazit“ für ihre „Leitstudie Integrierte Energiewende“ vorstellte, wobei die Dena nicht speziell auf den Wärmesektor abstellte. Dena trat an die Öffentlichkeit mit dem Anspruch, „Empfehlungen für Koalitionsverhandlungen“ abgeben zu können. Böll-Stiftung und AEE wollen den fehlenden Diskurs zwischen den Akteuren im Wärmesektor, vom Energieversorger über Wohnungsbaugesellschaften, Verwaltungen, Klima- und Sanierungsmanager, Stadtplanungs- und Ingenieurbüros, Handwerk, NGOs bis hin zu engagierten Bürgern, anschieben. Der Strategieworkshop lud Vertreter verschiedener „Stakeholdergruppen“ ein, sich auszutauschen und stellte die Frage, „gibt es ein gemeinsames großes Bild, wie man mit Blick auf die Klimaziele 2030 entscheidend vorankommen kann? Welche Akteure sind bereit, welche konkreten Schritte zu unternehmen?“
lesen Sie hier weiter
13.10.2017
EVS 30: Elektromobilität zum Anfassen
Elektromobilität und Batterietechnik stand im Mittelpunkt der EVS30, die vom 9. bis 11. Oktober erstmals in Stuttgart stattfand. Die von internationalen Verbänden getragene Veranstaltung wechselt jährlich zwischen Europa, Nordamerika und Asien.
Entsprechend stolz waren die Veranstalter kongressbegleitend über 350 Aussteller begrüßen zu dürfen. Die Konferenz war mit rund 1.500 Teilnehmern ebenfalls gut besucht. Elektromobilität zum Anfassen wurde auf den Messeständen präsentiert. Ein Trend: Ladesäulen mit mehr Komfort und immer höherer Ladeleistung. Neben der einfachen Bedienung und webbasierten Abrechnungssystemen bieten die Hersteller nun Ladesäulen mit immer höherer Ladeleistung und damit schnellerem Auftanken an.
So hat der Anbieter adstec aus der Nähe von Stuttgart eine Ladesäule mit einer maximalen Ladeleistung von 320 kW entwickelt, die mit einem 140 kWh-Batteriespeicher gekoppelt ist, um einen Einsatz auch in Netzbereichen zu ermöglichen, in denen der Abruf derartig großer Leistungen problematisch ist. Bei derart großen Leistungen muss technisch sogar eine Kühlung des Ladekabels umgesetzt werden, damit eine gefahrlose Bedienung möglich ist. Andere neue Ladetechniken wurden nicht nur in der Messehalle, sondern mit 50 Ladepunkten auch im Parkplatzbereich für Besucher zum praktischen Gebrauch angeboten, jedoch nur temporär während der Messezeit. Selbst Besucher aus den Niederlanden und der Schweiz bewiesen, dass die Reichweitendiskussion zum Teil in der Praxis kein Problem mehr ist. In der Halle wurden auch Probefahren für unterschiedliche Elektrofahrzeuge angeboten.
Neben dem mit geringer Leistung möglichen kabellosen Laden mittels Platte am Garagenboden wurde auch ein mobiles Ladegerät vorgestellt, das per Drehstromanschluss eine Schnellademöglichkeit mit bis zu 44 kW anbietet. Ein Nissan Leaf kann damit in 20 Minuten zu 80% aufgetankt werden. Insbesondere für Outdoor-Veranstaltungen wie Festivals ein interessantes Produkt. Dass sich die Elektromobilität nicht auf den PKW-Bereich beschränkt, wurde auch wieder deutlich. Neben dem Prototyp eines elektrischen Daimler-Trucks präsentierte man Fahrzeuge, die heute schon eingesetzt werden können. So zeigte der niederländische Aussteller emoss einen elektrisch umgerüsteten MAN-Truck, der bereits im Raum Köln bei einem Logistiker Auslieferungen für den Drogeriemarkt dm übernimmt.
Insgesamt wurde auf der Messe sichtbar, dass das Feld der Elektromobilität von vielen Zuliefern, darunter auch bekannten Namen wie Mahle oder Continental, massiv vorangetrieben wird. Doch der Auslandanteil von über 50 % bei den Ausstellern zeigt, wie weit auch viele Anbieter aus Skandinavien oder China bereits sind. Bei der Pressekonferenz der EVS30 betonte Henning Kagermann, Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektromobilität, dass die deutschen Autohersteller gut aufgestellt sind und in Westeuropa einen Marktanteil von derzeit fast 50 % erreicht haben. 100 verschiedene elektrische Fahrzeuge sollen bis 2020 von deutschen Herstellern verfügbar sein.
Der Baden-Württembergische Verkehrsminister Herrmann räumte ein, dass der Aufbau der Ladestruktur derzeit im Gange , bislang aber noch zu wenig koordiniert sei. So kümmerte sich bislang der Bund um Autobahnen und Bundesstraßen, die Länder um Landstraßen und die Kommunen organisierten Ladepunkten in den Gemeinden. Um ein optimales Ladenetz insbesondere auch in ländlichen Gebieten zu erreichen, streben die Verwaltungen hier eine bessere Verzahnung an. Franz Loogan von der Landesagentur Elektromobilität Baden-Württemberg betonte, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht zu Netzproblemen führt und insoweit „beherrschbar“ sei, ähnlich wie der Ausbau der Photovoltaik. Er verwies dabei auf die Verteilnetzstudie des Landes, die im April 2017 veröffentlicht wurde
Die EVS30 kann als erfolgreiche Veranstaltung angesehen werden, für das kommende Jahr wurde bereits eine Fortführung der Elektromobilitätsaktivitäten bei der Messe Stuttgart in Aussicht gestellt, auch wenn die EVS30 dann wieder auf einem anderen Kontinent stattfindet. Das „mission statement“ der Veranstalter zur EVS30: „Fossile Brennstoffe haben ihren Zenit überschritten. Wir sind davon überzeugt, dass Elektromobilität die Zukunft ist.“. Eine Hoffnung für die feinstaubgeplagten Stuttgarter.
Jörg Sutter
Impressionen von der EVS 30
13.10.2017
Kommunen meistern die Energiewende sehr unterschiedlich
„Kommunen meistern die Energiewende“: Gemeinsam hatten die freistaatsnahen Carmen-Berater und die Bezirksregierungen von Unter- und Mittelfranken zu einem Fachgespräch in den Frankenweinort Iphofen eingeladen. „Kommunen sind Akteure mit Vorbildfunktion – insbesondere beim effizienten Einsatz von Energie sowie beim Ausbau der Erneuerbaren Energien.“ Diese Erkenntnis ist beileibe nicht neu. Doch offensichtlich ist sie bis heute noch nicht bei allen Bürgermeistern und Gemeinderäten fest verankert, sonst hätte die Veranstaltung nicht so großen Zulauf gehabt. Freiflächen-PV – beim zweiten Versuch.
Das Motto „gemeinsam“ stand im Mittelpunkt vieler Erfahrungs-Vorträge. Darin ging es beispielsweise um Genossenschaften, welche Kommunen und Bürger gründen können, um große Freiflächen-Solarstromanlagen umzusetzen wie in Neusitz bei Rothenburg. Seine Erlebnisse bis zum Erfolg schilderte Bürgermeister Rudolf Glas. 2006 war der erste Versuch geplatzt: die PV-Anlage wurde abgelehnt, Dann sollten Windkraftanlagen gebaut werden sollen – aber wegen der Thermik sind auf der Frankenhöhe viele Segelflugzeuge unterwegs; die Windkraft: Ein „NoGo“ für die Regionalverantwortlichen. Dann endlich kam der erste Durchbruchsschritt: Ein Arbeitskreis „Energiekonzept“ wurde gegründet, „immer um die 25 Personen“, so Glas. Nach einer Fragebogenaktion mit 55% Rücklaufquote aus der Bevölkerung 2015 ein Sieben-Punkte-Beschluss – einer war die Freiflächen-PV. Inzwischen ist die erste Hälfte von 1,5 MW gebaut und in den Händen einer Genossenschaft – auch die Kommune ist daran beteiligt. „Und der Gemeinderat gibt Rückendeckung für alle Projekte“, da ist der Bürgermeister immer noch begeistert.
lesen Sie hier weiter
13.10.2017
18. Forum Neue Energiewelt 2017 am 16. und 17. November
Deutschland hat sich große Ziele gesetzt: Sektorkopplung, Netzumbau, Ausbau der Erneuerbaren, Digitalisierung für die Energiewirtschaft.
Rund 700 Teilnehmer diskutieren mit Experten, Insidern, CEO’s und Start-Ups über die brennenden Fragen der neuen Energiewelt. Hier netzwerken die Unternehmer aus den Bereichen Projektentwicklung, Finanzierung, Technik, Energieversorgung, Herstellung und tauschen sich über die neuesten Trends und Geschäftsmodelle aus. Wie können wir die neue Energiewelt mit Leben füllen? Was bedeuten Netzumbau, Blockchain und Digitalisierung für die Energiewirtschaft? Diese und weitere Fragen sollen auf dem 18. Forum Neue Energiewelt 2017 geklärt werden.
Ausschnitt aus dem Grußwort von Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: ...Es geht um nichts weniger als darum, die Energiewende noch umfassender zu denken. Wir müssen dafür sorgen, dass die verschiedenen Elemente optimal ineinandergreifen. Das gilt für die Synchronisierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien mit dem Netzausbau ebenso wie für die Verknüpfung von Strommarkt und Erneuerbare Energien. Mit der Energiewende haben wir ein Zukunfts- und Modernisierungsprojekt für Deutschland angestoßen. Dazu gehört auch die umfassende Digitalisierung der Energiewende: Mit smart meter, smart home und smart grid können völlig neue Geschäftsmodelle entstehen. Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende haben wir dafür die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen. Denn wir brauchen eine moderne Infrastruktur, die zur Energiewende passt.
Die Erneuerbaren Energien liefern heute fast ein Drittel des Bruttostromverbrauchs. Sie sind längst fest etabliert. Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes hat den weiteren Ausbau für alle Beteiligten planbar und bezahlbar gemacht. Mit der Umstellung von der Festvergütung auf wettbewerbliche Ausschreibungen sind die Kosten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gesunken. Die nächste Phase der Energiewende hat das Strommarktgesetz eingeleitet. Es hat die Marktmechanismen auf dem Strommarkt gestärkt. Das sorgt für mehr Wettbewerb zwischen den Teilnehmern und einen flexiblen und damit kostengünstigen Ausgleich von Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und der Stromnachfrage. Außerdem haben wir den Strommarkt europäisch ausgerichtet. Ein funktionierender europäischer Strommarkt erhöht die Versorgungssicherheit und senkt die Kosten.
Die SONNENENERGIE ist Medienpartner des Forum Neue Energiewelt.
Weitergehende Informationen zu dem diesjährigen Forum
Am Freitag, den 17.11.2017 findet auf dem Forum Neue Energiewelt von 10.00 – 11.30 Uhr die Session "Qualität von PV-Bestandsanlagen" in Kooperation mit der DGS statt.
Hintergrund: Qualität spielt für den Photovoltaikmarkt eine große Rolle. Das ist bei den Millionen Euro an Investitionen mehr als berechtigt. Welche Qualität haben die Bestandsanlagen, welche Erträge werden erbracht und wie können sie bewertet werden? Welche Praxiserfahrungen und Statistik gibt es zum Betrieb von PV-Modulen? Welche Serienfehler waren relevant und welche Ausfallursachen gab es? Wie kann die Anlagengüte ermittelt werden und welche technische Aufrüstung ist möglich, welche Optimierungspotenziale bestehen? Welche EEG-rechtlichen Anforderungen bestehen beim Austausch von Anlagenkomponenten bei Bestandsanlagen?
Die Vorträge der Session werden sich mit diesen Fragestellungen befassen und im Anschluss diskutiert. Das fachkundige Wissen der Referenten gibt so Investoren und Betreibern wichtige Hinweise, um PV-Projekte zum Erfolg zu führen bzw. die Güte und den Wert von bestehenden Anlagen einzuschätzen und ggf. zu optimieren.
Moderation und Leitung: Ralf Haselhuhn, Fachausschussvorsitzender Photovoltaik der DGS
Verkehrswertermittlung von PV-Anlagen: Björn Hemmann, DGS Franken e.V.
Betriebsanalyse von PV-Modulen 2008-2015: Sönke Jäger, Adler Solar Service GmbH
Technische Prüfung und Qualitätsverbesserung: Udo Siegfriedt, DGS Berlin Brandenburg e.V.
Austausch von Anlagenkomponenten - Rechtliche Grundlagen und Regelungen des EEG: Dr. Martin Winkler, Clearingstelle EEG
13.10.2017
30. World Solar Challange
Seit 30 Jahren findet in Australien die World Solar Challenge statt. Die Strecke führt von Darwin nach Adelaide, die Streckenlänge beträgt 3.000 km. Teams aus über 30 Ländern nehmen daran teil. Die Fahrzeuge sind Unikate, sie wurden selbst konstruiert und mit den eigenen Händen gebaut.
Auch bei der diesjährigen World Solar Challenge dreht sich alles um Energiemanagement. Basierend auf der ursprünglichen Vorstellung, dass ein 1.000 W-Auto die Reise in 50 Stunden absolvieren würde, sind Solarautos erlaubt, die einen Speicher mit dem Energieinhalt von 5 kWh besitzen. Die restlichen 90 % der muss von der Sonne kommen oder aus der kinetischen Energie des Fahrzeugs gewonnen werden.
Während der Reise gibt es sieben obligatorische Kontrollpunkte, an denen die Beobachter gewechselt werden müssen und die Teamleiter sich mit den neuesten Informationen über das Wetter und ihre Position auf dem Feld versorgen können. An den Kontrollpunkten können die Teams nur die grundlegendsten Wartungsarbeiten durchführen - Kontrolle und Wartung des Reifendrucks und Reinigung der Rückstände vom Fahrzeug.
Matthias Hüttmann
(frei übersetzt, lesen Sie hier das Original mit Fakten, Bildern und Liveticker)
13.10.2017
Dezentrale Stromspeicher – Bausteine der Energiewende
Am Samstag, den 18. November findet in Stuttgart von 10 Uhr bis 16 Uhr das Seminar "Dezentrale Stromspeicher – Bausteine der Energiewende" statt. Ort ist das Bischof Moser-Haus in der Wagnerstraße 45. DGS-Vizepräsident Jörg Sutter wird dort zwei Vorträge halten, seine Themen: "Haushaltsspeicher, Gewerbespeicher, Quartierspeicher - Neue Anwendungsmöglichkeiten für Stromspeicher" und "Solar Clouds - gebündelte Speichermacht?".
Hintergund: Der Markt für Lithium-Akkus und andere Batteriespeicher explodiert gerade. Im Blick der breiten Öffentlichkeit ist dabei vor allem die Elektromobilität aber auch die Stromspeicherung um den Eigenverbrauch zu optimieren. Wichtig sind die Stromspeicher für die Energiewende aber als Ausgleich zur volatilen Erzeugung aus Wind und Sonne. Welche Entwicklungen gibt es aktuell im Energiespeichermarkt? Wie stellt sich die Umweltbilanz dar? Was sind die politischen Rahmenbedingungen? Informationen, Antworten und Diskussionen dazu beim BUND-Seminar.
Weitergehende Infos und Anmeldung
13.10.2017
Kleiner Medienspiegel
Lithium-Ionen-Batterie: Toshiba verdoppelt Anoden-Kapazität: Der japanische Konzern hat die erfolgreiche Weiterentwicklung seiner Lithium-Ionen-Batterie SCIB angekündigt. Sie verwendet anstelle von Graphit-basierten Anoden ein Titan-Nioboxid-Anodenmaterial und soll damit die Kapazität der Batterie verdoppeln. Die neue Batterie verspricht eine hohe Energiedichte und kurze Aufladezeiten für Automobilanwendungen. So soll bei einem kompakten Elektrofahrzeug eine Reichweite von 320 km nach einer Ladezeit von nur sechs Minuten möglich werden – dreimal so weit, wie es derzeit mit den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien der Fall ist. Toshiba hatte die SCIB im Jahr 2008 auf den Markt gebracht. Sie gilt seither als sicher, langlebig und schnell aufladbar. Dies sei keine allmähliche Verbesserung, sondern ein bahnbrechender Vorstoß, der einen signifikanten Unterschied bei der Reichweite und der Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen machen werde, verkündete Toshiba. Sollte sich diese Ankündigung bewahrheiten, würde dies auch gravierende Auswirkungen auf die deutsche Automobilindustrie haben, die offenbar keinen Anteil an der Entwicklung auf dem Batteriesektor hat: Akku für Elektroautos von Toshiba: 6 Minuten laden für 320 km
Neue Heliostaten könnten Bewegung in die Solarstrompreise bringen: Forscher der Sandia National Laboratories in Ohio haben einen Heliostaten entwickelt, der um ein Drittel günstiger arbeitet als heute eingesetzte. Heliostate sind Spiegel, die mit Hilfe von Motoren so bewegt werden, dass sie die Wärmestrahlen der Sonne stets auf einen Receiver an der Spitze eines Turms konzentrieren. Im Receiver werden Temperaturen von 800 Grad Celsius erreicht. Diese Wärmeenergie wird an einen Wasser-Dampfkreislauf übertragen, der Standard-Turbogeneratoren zur Stromerzeugung antreibt. Während jeder Heliostat in einem heute existierenden Solarturmkraftwerk von einem eigenen Motor bewegt wird, nutzt die neue Entwicklung einen einzigen Motor, um eine ganze Reihe von Spiegeln zu bewegen. Die Stromkosten könnten dadurch um 13 Prozent sinken. Anders als Solarstrom aus Zellen, der nur dann fließt, wenn die Sonne scheint, produzieren solarthermische Kraftwerke auch nach Sonnenuntergang. Ein Teil der solaren Wärme wird tagsüber in einen riesigen Salzspeicher geleitet. Nachts wird diese Energie genutzt, um wiederum Strom zu erzeugen. Diese indirekte Stromspeicherung ist weitaus billiger als die Pufferung in Batterien, die bei photovoltaisch erzeugter Energie die einzige Möglichkeit ist, Solarstrom auch nachts zu nutzen: Geniale Technologie: 800 Grad Höllenfeuer treibt Solarstrompreise in den Keller
Wasserstoff im Brandenburger Zugverkehr: Niederbarnimer Eisenbahn, Alstom Transport Deutschland, Enertrag und die Barnimer Eisenbahngesellschaft BEG wollen ein Pilotprojekt für emissionsfreien Schienenverkehr starten, wie der IWR-Pressedienst berichtet. Mit regional erzeugtem Wasserstoff aus uckermärkischer Windenergie könnte die in Berlin und Brandenburg bekannte und beliebte „Heidekrautbahn“, die als RB27 Strecken in den Landkreisen Barnim und Oberhavel, vor der Berliner Stadtgrenze, bisher dieselgetriebenen Fahrzeuge durch Brennstoffzellenantrieb ersetzen. Der Wasserstoff für die neuen Züge würde durch eine Erweiterung des Hybridkraftwerks von Enertrag bereitgestellt werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieser innovativen Projektidee beträgt ca. 35 Mio. EUR. Voraussetzung für die Realisierung ist eine Projektförderung aus Bundes- und Landesmitteln. Unter anderem strebt das Konsortium eine Antragstellung im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) an. Die Umsetzung dieser Fördermaßnahmen wird durch die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) koordiniert: Wasserstoff im Brandenburger Zugverkehr und Mit Wind und Wasserstoff umweltfreundlich in Brandenburg unterwegs
Neues Zentrum für höchsteffiziente Solarzellen: Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE erhält am Standort Freiburg ein neues "Zentrum für höchsteffiziente Solarzellen". Der Bund und das Land Baden-Württemberg setzen mit der Finanzierung des Gebäudes mit neuester Reinraum-Ausstattung in Höhe von 32,6 Mio. Euro ein Zeichen für die Bedeutung der Photovoltaik-Forschung in Deutschland, während die Herstellerindustrie ums Überleben kämpft. Der Bund und das Land Baden-Württemberg stellen für dieses Projekt die Summe von insgesamt 32,6 Mio. Euro bereit. Die Fertigstellung des neuen Zentrums ist für Ende 2019 geplant. Damit sei man für die kommenden Solarzellengenerationen vorbereitet, teilt das Fraunhofer ISE mit. „Die Ergebnisse unserer Energiesystemanalysen mit Blick auf eine kosteneffiziente Umsetzung der Energiewende zeigen deutlich, dass die Photovoltaik zusammen mit der Windenergie die tragenden Säulen unserer künftigen Energieversorgung sein werden“, so Professor Hans-Martin Henning, einer der beiden Institutsleiter.
Solarworld-Chef Asbeck: Brauchen Solarindustrie in Deutschland: Während die Photovoltaik-Forschung in Deutschland auch im internationalen Vergleich sehr gut dasteht, ist die Herstellerindustrie hierzulande in den vergangenen Jahren immer weiter verschwunden. Der allergrößte Teil der Produktion von Solarzellen und Modulen befindet sich in Ostasien, insbesondere China. Trotz einiger Krisen ist Solarworld als einer der letzten Photovoltaik-Hersteller noch in Deutschland tätig. Der Solarkonzern hat sich gerade eben nach einer Insolvenz neu aufgestellt. Solarworld-Gründer Frank Asbeck hat in einem Interview erklärt, warum er weitermacht. Er sei fest davon überzeugt, dass in Deutschland eine Solarindustrie gebraucht werde. Gegenüber dem Fachportal Solarthemen unterstrich Asbeck, dass „jede Entwicklung, die in China einige Jahre später nachvollzogen wurde, aus Europa kam“. Daher habe man auch in Deutschland „immer noch einen Schatz“: Photovoltaik-Standort Deutschland bekommt "Zentrum für höchsteffiziente Solarzellen"
Windstromproduktion legt im Jahresvergleich zu – Solarstrommenge geht zurück: Die Windkraft- und Solaranlagen in Deutschland haben im September 2017 zusammen 9,4 Mrd. kWh Ökostrom produziert. Damit ist die Erzeugung erstmals seit Januar 2017 wieder unter die Marke von zehn Mrd. kWh gefallen. Dennoch wurde 16 % mehr als im September 2016 (8,1 Mrd. kWh) produziert. Das geht aus den bislang vorliegenden Daten der Transparenzplattform Entso-e der europäischen Übertragungsnetzbetreiber hervor, wie der IWR-Pressedienst berichtet. Gestützt durch den letztjährigen Zubau an Windenergieleistung wurden im September 2017 etwa 6,3 Mrd. kWh Windstrom erzeugt. Das sind knapp 50 % mehr als im September 2016 (4,2 Mrd. kWh). Der Anteil der Offshore-Windenergie steigt auf etwa 1,0 Mrd. kWh, was einem Zuwachs von rund 44 % gegenüber September 2016 entspricht. Die PV-Stromerzeugung im September 2017 fällt mit 3,1 Mrd. kWh rund 20 % geringer aus als im Vorjahr (September 2016: 3,8 Mrd. kWh). Dieser Rückgang ist bedingt durch den niedrigeren Sonnenstand und die Wetterlage. Im Vormonat August lag der Wert noch bei 4,6 Mrd. kWh: Regenerative Stromerzeugung im September
Eon und Enel haben über einen neuen Marktplatz erstmals mit der Blockchain-Technik Strom gehandelt: Die Geschäfte könnten in Sekunden direkt untereinander abgewickelt werden, beschreibt der Energiekonzern das Verfahren. Es sei kein zentraler Vermittler erforderlich, was die Kosten der Strombeschaffung senke. Künftig sollten auch die Kunden von diesem direkten Stromhandel per Blockchain und damit von der Kostensenkung profitieren, lies Eon verlauten. Der deutsche Energiekonzern habe den dezentralen Großhandel in seinem Future Lab im vergangenen Jahr getestet. Eingesetzt wurde dabei ein Peer-to-Peer-Netzwerk des IT-Spezialisten Ponton. Im Mai dieses Jahres gründeten die Konzerne mit weiteren Partnern die „Enerchain“-Initiative. Daran haben sich Berichten zufolge mittlerweile 33 Unternehmen zusammengeschlossen und einen dezentralen europäischen Marktplatz für den Energiehandel entwickelt: E.ON treibt die Digitalisierung der Energiewirtschaft voran
Registrierungspflicht auch für Stromspeicher: In den letzten Jahren investierten PV-Anlagenbetreiber in insgesamt in über 50.000 Stromspeicher, um die Eigenversorgung zu steigern und gegen Strompreissteigerungen und Netzausfälle gewappnet zu sein. Dass bereits seit 01.08.2014 eine Registrierungspflicht für Speicher bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) besteht, scheinen die wenigsten Speicherbetreiber wissen. Die Registrierungspflicht trifft alle Speicher, die ab diesem Zeitpunkt in Betrieb gesetzt wurden und ausschließlich mit Strom aus Erneuerbaren Energien geladen wurden. Darauf weist der Solarenergie Förderverein ausdrücklich noch einmal hin. Auf die Meldepflicht konnten Anlagenbetreiber letztlich nur dann aufmerksam werden, wenn sie die komplexen Bestimmungen des EEG und die dazugehörigen Verordnungen im juristischen Wirrwarr der Regelungen und Restriktionen gelesen und auch verstanden hatten. Davon ist in den wenigsten Fällen auszugehen. Bis August 2017 wurden gerade mal 135 Speicher bei der BNetzA registriert. Diese Rechtslage hatte sich zunächst aus der ehemaligen Anlagenregisterverordnung ergeben und war dann in die ab 01.09. geltende Marktstammdatenregisterverordnung übernommen worden. Alle Regelungen bezogen sich auf den Anlagenbegriff im EEG 2014/2017. Formular zur Registrierung des Stromspeichers: Bundesnetzagentur und Registrierungspflicht auch für Stromspeicher
Klaus Oberzig