13.01.2017
2017 – Komplizenschaften aufkündigen!
Die DGS wünscht allen Lesern ein gesundes und gutes Jahr 2017. Möge es nicht alles halten was es verspricht! Bereits das Jahr 2016 war ein in vielerlei Hinsicht aufregend, auch für die DGS. Es war das Jahr, in dem, so massiv wie noch nie zuvor, Hand an die Energiewende gelegt wurde. Speziell den Projekten der Bürgerenergie-Bewegung wurden auf breiter Ebene die Existenzbedingungen entzogen. Was sich schon länger abgezeichnet hatte, trat ganz offen zu Tage: Es gibt ein der ursprünglichen Vision der Energiewende gegensätzliches Modell, das mit aller Macht durchgesetzt werden soll. In Anlehnung an Begrifflichkeiten aus der Politikwissenschaft, könnte man die konträren Projekte auch als grau und grün differenzieren - letzteres sollte jedoch nicht parteipolitisch missverstanden werden. Prof. Peter Droege, Präsident von Eurosolar, kennzeichnete die konträren Vorstellungen als zentralistisch versus dezentral/demokratisch.
Was gleichfalls immer deutlicher wird: Es gibt keinen Konsens zwischen der grünen Bürgerenergie-Bewegung, die dezentral, demokratisch und emissionsfrei sein will und der grauen Offensive der Energiemonopole, die den zentralen Betrieb fossiler Energieerzeugungsanlagen noch einen weiteren Investitionszyklus hinausschieben wollen. Das bittere: Die gegenwärtige Bundesregierung ist Teil des grauen Konglomerates. Sie spielt ein Doppelspiel, indem sie verbal die Fahne der Energiewende schwenkt, praktisch aber diese mit anderen Inhalten füllt. Um dem entgegenzuwirken, muss der Begriff Energiewende jedoch nicht neu erfunden werden, sondern kräftiger mit Inhalten gefüllt werden, die unmissverständlich sind wie Dezentralität, Akteursvielfalt, Akzeptabilität, soziale Verträglichkeit, technologische Vielfalt und Nachhaltigkeit.
Aber es gab auch positives: Die DGS konnte 2016 so viele Neueintritte verzeichnen wie schon sehr lange nicht mehr. Das lässt uns hoffen. Auch wenn der Anlass wahrscheinlich weniger ein Grund zum Feiern ist, spornt es uns trotzdem an. Offensichtlich sehen viele Menschen die Energiewende ebenso in Gefahr. Diese Zustimmung werden wir zu nutzen versuchen, um Positionen zu entwickeln und Bündnispartner zu finden, um den Weg zu 100 % Erneuerbare bis 2050 oder besser früher ohne Verzögerungen fortsetzen zu können. Und auch wenn es nicht einfach sein wird, glauben wir noch an eine positive Wendung, denn wie sagte schon Oscar Wilde: Everything is going to be fine in the end. If it's not fine it's not the end.
Komplizenschaften
In zwei Veröffentlichungen der jüngsten Zeit findet sich ein Begriff, der die Aufgabe, vor der wie stehen, sehr gut umschreibt. Zuerst war er bei Hans Joachim Schellenhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgeforschung, im Zusammenhang mit dem Klimaschutz zu lesen. So schreibt er, dass die Mächte und Kräfte des unbeschränkten Marktkapitalismus - oder auch des marktradikalen Denkens, wie es bei Randers und Maxton in ihrem neuen Bericht an den Club of Rome heißt - nur deshalb so zerstörerisch wirken können, weil fast alle Menschen Komplizen der Untat sind. Wir verhalten uns gelegentlich aktiv, zumeist aber passiv. Nur wenn wir diese Komplizenschaft aufkündigen würden, fingen Regierungen rasch zu schwanken an und stolze Konzerne würden demütig.
Ganz gemäß Hans Jonas, Philosoph und Autor des Buches "Das Prinzip Verantwortung", der schon 1979 davon sprach, dass es weniger ein Recht künftiger Menschen auf Glück, sondern vielmehr eine Pflicht gegenüber der Zukunft der Menschheit gebe. Es ist daher höchste Zeit zum Handeln.
In einem ganz anderen Zusammenhang ist der Begriff der Komplizenschaft ebenso passend genannt worden. 2016 war bekanntlich ebenso durch eine rapide Abnahme an Empathie und dem Aufkommen von verbaler wie auch physischer Gewalt geprägt. Carolin Emcke, die 2016 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt, beschreibt das sehr treffend, wenn Sie formuliert: Überall dort, wo die, die nicht der Norm entsprechen, zu Boden gerempelt werden, überall dort, wo niemand ihnen wieder aufhilft, wo sich niemand entschuldigt, überall dort, wo die, die etwas abweichen, zu etwas Monströsem gemacht werden, da entsteht Komplizenschaft zum Hass. Auch diese Komplizenschaft gilt es aufzukündigen bzw. nicht beizutreten.
Fazit: Wir benötigen mehr Solidarität, um im ökonomischen Sprachgebrauch zu bleiben: Wir benötigen nicht nur eine Sharing Economy sondern vielmehr eine (grenzüberschreitende) Sharing Society!
Matthias Hüttmann (und Klaus Oberzig)
13.01.2017
Gewinnspiel - Auflösung
Kurz vor Jahresschluss startete unser Gewinnspiel bei dem man einen DGS SolarRebell gewinnen konnte. Eine Tag vor Heilig Abend haben wir uns mit einem Gewinnspiel von unseren Lesern verabschiedet. Diese wurde von der DGS, zusammen mit unserem SolarRebell-Partner miniJOULE für das Gewinnspiel gespendet. Es handelte sich um eine Kleinst-PV-Anlage, bestehend aus einem 250 Wp-Solarmodul, einem Wechselrichter, einer Unterkonstruktion aus Aluminium und Montagematerial. Einsendeschluss war der 06. Januar 2017.
Die Resonanz war mit 56 Teilnehmern durchaus gut, da man davon ausgehen muss, dass zum Zeitpunkt des Newsletterversands am 23.12. die meisten unserer Leser mit anderen Dingen beschäftigt waren. Von den 56 Teilnehmern haben 25 alle Fragen richtig beantwortet, die restlichen 31 hatten leider jeweils eine Frage falsch beantwortet. Die meisten sind an der Frage gescheitert, wie viele digitale Ausgaben der SONNENENERGIE bislang erschienen sind.
Wie man am Ergebnis sehen konnte, waren die sechs Fragen nicht allzu schwierig, jedoch musste man bei der ein oder anderen Frage schon ein wenig auf unseren Internetseiten www.dgs.de und www.sonnenenergie.de stöbern, um die Lösung zu finden. Hier nochmals die Fragen, jetzt mit den Antworten:
1. Wie viele Newsletter haben wir 2016 verschickt?
Es waren genau 44, man kann dies am besten im Newsletter-Archiv nachzählen.
2. Wie oft erschien die SONNENENERGIE bisher als digitale Version?
Genau 18 Mal. Die Übersicht zu den digitalen Ausgaben der SONNENENERGIE finden Sie hier.
3. Wann erschien der erste Teil unserer Après Paris-Reihe und wie heißt der Autor?
Das war im Heft 2/2016. Der Autor war Dr. Georg Feulner.
4. Wie viele Bewertungssterne hat das Buch "Planetary Urbanism" erhalten?
Es bekam 4 Sterne. Buchbesprechungen finden Sie hier.
5. Zu welchem Datum haben wir das Gespräch mit Hans-Josef Fell im Newsletter veröffentlicht?
Es war der Newsletter vom 22.04.2016.
6. Wie viele Mitgliedsfirmen findet man aktuell in der DGS Firmen-Online-Datenbank?
Es sind 307 bzw. 308 Firmenmitglieder. Das hängt ganz davon ab, wann Sie an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Die Firmendatenbank finden Sie hier.
Nächste Woche werden wir den glücklichen Gewinner unserer Gewinnspiels präsentieren.
13.01.2017
Die Aarhus-Konvention und das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz: Gilt - gilt nicht - gilt - gilt sie?
Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal von der „Aarhus Konvention“ gehört? Die ist nach der dänischen Viertelmillionen-Hafenstadt, Europas Kulturhauptstadt 2017 benannt und dort bereits 1998 unterzeichnet worden. Die Aarhus-Konvention ist der erste völkerrechtliche Vertrag, der jeder Person Rechte im Umweltschutz zuschreibt. Seit 2006 gilt „Aarhus“ ganz offiziell auch in Deutschland.
Dennoch ist die Umsetzung der Aarhus-Vorgaben offenbar noch lange nicht abgeschlossen. „Es droht eine völkerrechtliche Zweitverurteilung Deutschlands durch die Gremien der Aarhus-Konvention wegen der festgestellten Völkerrechtswidrigkeit deutschen Rechts“, schreibt Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks (SPD) am 15. Dezember an Kanzleramtsminister Peter Altmeier (CDU) in einem uns vorliegenden Brief. „Eile“ fordert Hendricks bei der „andauernden Diskussion in der Unionsfraktion“ zur Novelle des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG). Das UmwRG hängt mit Aarhus direkt zusammen. Und dessen „völkerrechtswidriger“ Inhalt könnte auch die Wege für neue Höchstspannungsleitungen und –kabel zwischen Nord- und Süddeutschland betreffen. Die wurden im „Gesetz über den Bundesbedarfsplan (BBPlG)“ und dem dazugehörigen Netzentwicklungsplan (NEP) fest geschrieben.
Für Kritiker wie Dörte Hamann vom „Aktionsbündnis gegen die Süd-Ost-Trasse“ aus Leinburg bei Nürnberg ist „die NEP laut Aarhus-Konvention nicht rechtskonform“. Denn „mit dem Netzentwicklungsplan bekommen wir schon die fertige Planung vorgelegt. Aarhus aber verlangt eine verbindliche Öffentlichkeitsbeteiligung, so lange noch alle Optionen offen sind“, meint Hamann. Ein erfahrener Verwaltungsrechtler „kann der Argumentation eine Menge abgewinnen“.
1998 wurde „Aarhus“ beschlossen, ist also nicht neu. 46 Staaten, darunter alle EU-Mitglieder und die Europäische Union selbst haben den Vertrag ratifiziert. Der regelt im Wesentlichen den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten. Brigitte Artmann, Grüne Kreisvorsitzende aus Wunsiedel, hat die Konvention bereits mehrfach erfolgreich genutzt, um Genehmigungsverfahren für Kernkraftwerke anzugreifen, z.B. jene zu den seit Jahren geplanten Blöcken 3 und 4 im Böhmischen Temelin. Das Komitee habe ihr bestätigt: „Deutsche Behörden haben die Öffentlichkeit über Temelin nicht ausreichend informiert.“
Nur was nützt ein Aarhus-Spruch, wenn sich die Gerüffelten nicht daran halten? „Man muss klagen, vor ordentlichen Gerichten“, gibt Brigitte Artmann zu. Und das sei teuer. Denn eigene Kosten bekomme man nicht ersetzt. Dabei steht laut Dr. Matthias Sauer vom Bundesumweltministerium (BMUB) in Artikel 9 der Aarhus-Konvention: Verfahren vor Gerichten müssten angemessenen, effektiven, sogar vorläufigen Rechtsschutz sicherstellen und zudem „fair, gerecht, zügig und nicht übermäßig teuer“ abgewickelt werden. Wie beschrieben, erleben Kritiker Anderes. Doch nicht deshalb steht laut Sauer „die aktuelle Novelle zum Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) unter einem besonders hohen Zeitdruck“, sondern wegen des „Compliance Beschluss V/9h der 5. VSK vom 2.07.2014“, einer Aarhus-Entscheidung gegen Deutschland: So fehle „bei vielen einschlägigen Rechtsvorschriften eine Klagemöglichkeit für Umweltvereinigungen“.
Eigentlich hätte das überarbeitete UmwRG zum Jahreswechsel in Kraft treten müssen, weshalb Ministerin Hendricks „viele Millionen Euro Strafen“ auf Deutschland zukommen sieht. Denn das Gesetz wird 2017 immer noch beraten. Auch deshalb stellten die Umweltverbände UfU, DNR, BUND und NABU kürzlich gemeinsam klar: „10 Jahre Aarhus sind kein Grund zum Feiern. Trotz der Ratifizierung im Dezember 2006 ist Bürgerbeteiligung im Umweltschutz im Allgemeinen nicht verbessert worden. Deutschland hat die Aarhus-Konvention somit unzureichend umgesetzt.“
Peter Rottner, Landesgeschäftsführer des BUND Naturschutz in Bayern, ist gar nicht euphorisch, was die konkreten Auswirkungen von „Aarhus“ betrifft. Zum deutschen BBPlG für Stromnetze meint er: „Selbst wenn das Gesetz nicht rechtskonform ist, muss gegen jede einzelne Leitung geklagt werden.“ Gerade in Bayern, wo die Proteste gegen die Hochspannungstrassen immer noch nicht abgeebbt sind. Trotz der nicht ausgeräumten Differenzen mit den Verbänden sieht das BMUB „besonders hohen Zeitdruck“. Denn laut einer BMUB-Sprecherin werde der Gesetzentwurf „den Anforderungen der Aarhus-Konvention uneingeschränkt gerecht.“ Aber die Novelle des UmwRG steht selbst im Januar 2017 nicht auf dem Kalender des Bundestags, heißt es von der Pressestelle des Parlaments.
Im Oktober 2016 gab sich die Bundesregierung zuversichtlich: Ihr Entwurf sei „eine 1:1-Umsetzung der Vorgaben des EU- und Völkerrechts“. Das sieht Brigitte Artmanns „Aarhus Konvention Initiative“ genau anders. Die hat zum Gesetzentwurf folgendermaßen Stellung genommen: „Die vorgesehenen Änderungen des UmwRG sind nicht geeignet, die völkerrechtlichen Vorgaben der Aarhus Konvention zum Zugang zu Gericht in Umweltangelegenheiten ausreichend umzusetzen.“
Heinz Wraneschitz
Links:
www.aarhus-konvention-initiative.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Aarhus-Konvention
Ergänzung:
Zu diesem Beitrag über die Aarhus-Konvention und das Umweltrechtsbehelfsgesetz möchten wir folgendes ergänzen:
Eine Aussage von Brigitte Artmann von der Aarhus-Konvention-Initiative zu den Kosten einer eventuellen Klage wurde verkürzt wiedergegeben. Vollständig hat uns Brigitte Artmann erklärt: "Falls der Gesetzgeber eine Entscheidung des Aarhus Komitees nicht freiwillig umsetzen sollte, so kann man diese vor deutschen Gerichten einklagen. Beschwerden vor dem Aarhus Komitee mit eigenem Rechtsanwalt sind teuer, weil man diese Ausgaben nicht mehr zurück bekommt."
13.01.2017
Alte Industrie – neue Gedanken: Aluminium-Stromspeicher
Mit seiner Idee, seine Aluminiumöfen als Speicher für überschüssigen Ökostrom zu nutzen, geht der Essener Familienbetrieb Trimet einen für die Metallbranche ganz neuen, innovativen Weg.„Das war halt schon immer so!“ Dieser Standardsatz deutschen Beharrungsvermögens gegen alles Neue galt laut Professor Dietmar Tutsch bisher auch für die hiesige Aluminiumindustrie. „Wie man den Herstellvorgang von der Prozesstechnik her am besten in Gang hält, dazu gibt es noch sehr wenig Wissen“, sagt der Projektleiter des Forschungsprojekts „Aluminiumproduktion mit regenerativen Energien“. Hier sollen Aluminiumöfen als Ökostromspeicher genutzt werden. Das in Kooperation zwischen „seiner“ Bergischen Universität Wuppertal (BUW) und dem Essener Aluminiumhersteller Trimet Aluminium SE gerade angelaufene Projekt will mit dem „Das war halt schon immer so!“ bei Aluminium Schluss machen. Schuld daran ist eine zweite deutsche Eigenart: Familienbetriebe bleiben möglichst selbst dann im Land, wenn die Rahmenbedingungen für die Produktion alles andere als rosig dafür sind.Das Gejammer der stromintensiven Industrie wegen vermeintlich zu hoher Strompreise hierzulande ist allgegenwärtig. Immer vornedran war dabei die Aluminiumindustrie: Sie kündigte wegen des 45-prozentigen Stromkostenanteils wieder und wieder die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland an. Doch auch wenn seit 2011 die Zahl der Beschäftigten konstant bei 74.000 liegt, der Umsatz der 600 hiesigen Betriebe seit 2013 sogar um 20% anstieg: Die Branche, oft in internationalen Konzerne eingebunden, droht immer weiter. Der Mittelstand ist anders gestrickt
Die 1985 gegründete, mittelständische Trimet SE mit ihren 3.000 Mitarbeitern beteiligt sich daran nicht, nimmt nun sogar Abschied vom „Das war schon immer so!“ bei der Produktion. „Lastverschiebung als Lösungsbeitrag zur Energiewende“ versprach Martin Iffert, der Vorsitzende des Vorstands, im September letzten Jahres. Dafür habe sein Unternehmen „ein Verfahren entwickelt, das den Elektrolyseprozess durch eine flexible Lastverschiebung an schwankende Strommengen aus Wind- und Sonnenenergie anpasst“. Genau darum geht es nun im neuen Forschungsprojekt mit der BUW. „Bislang wird Aluminium mit konstanter Stromstärke produziert“, erläutert Prof. Tutsch. Dadurch hielten die Hersteller ihre Öfen auf vermeintlich konstanten Temperaturen, „auch wenn man die nicht kontinuierlich messen kann“: Es gebe schlichtweg keine Sensoren, die das aushielten. Doch Tutsch ist sicher, dass die Schmelze auch in einem Temperaturband von +/- 50 Kelvin um das Optimum problemlos funktioniert. Mit „Big Data, also einem Data Mining (Daten sammeln; d.Red.) von Prozessdaten, Außentemperaturen, Bauxitmengen und mehr wird auf den tatsächlichen Zustand im Ofen geschlossen. Daraus soll eine Gesamtregelung entworfen werden“, erläutert der Professor die Aufgabe des BUW-Teams. „Wenn man weiß, es lässt sich beispielsweise zwei Stunden ohne Stromzufuhr produzieren, kann man auf die Strombörse schauen und den Strom dann kaufen, wenn Überschuss aus Wind oder Sonne da ist“, sprich der Strompreis im Keller oder gar negativ. Das machen sich schon jetzt beispielsweise kommunale Wärmeversorger in Nürnberg oder Heidelberg zunutze: Die beheizen mit überschüssigem Ökostrom riesige Wassertanks ihrer Fernwärmenetze. Nun bekommen die den Aluhersteller Trimet als Konkurrenz. Der will „bis Ende 2017 sämtliche 120 Öfen einer Elektrolysehalle der Aluminiumhütte in Essen umrüsten“; für rund 36 Millionen Euro, so Vorstand Iffert. Und zwar vor allem für „optimiertes Kathodendesign, das Abwärme-Management an der Ofenoberseite, die detaillierte Überwachung und Steuerung der Anodenstromverteilung, die Regelung der Badchemie sowie eine ganzheitliche Prozessoptimierung unter Einbettung aller Teilprozesse in eine prozessübergreifende, intelligente Regelung des Gesamtsystems“, zählt Prof. Tutsch notwendige Maßnahmen auf.
Sein Unternehmen nehme „mit der Flexibilisierung der Aluminiumproduktion eine weltweite Vorreiterrolle ein“, ist Trimet-Vorstandschef Martin Iffert sicher. Außerdem „wollen wir einen entscheidenden Lösungsbeitrag zur Energiewende liefern und gleichzeitig den Nachweis erbringen, dass Industrieproduktion und klimaschonende Energieversorgung nicht nur im Einklang stehen, sondern sich sogar wechselseitig unterstützen können“. Die Uni-Forscher erwarten, alleine eine optimierte und flexible Aluproduktion lasse „perspektivisch in Deutschland den CO2 Ausstoß um 160.000 Tonnen im Jahr mindern“. Dazu komme der mögliche Umweltnutzen „durch die Minderung der Kraftwerksemissionen in Deutschland durch den flexiblen Hüttenbetrieb von 160.000 bis 320.000 Tonnen CO2 pro Jahr“. Heinz Wraneschitz
13.01.2017
Neu: Zertifizierte DGS/VDE-Fachkraft Photovoltaik sowie Elektrische Energiespeicher
Im Jahr 2016 beschlossen der VDE Offenbach und der DGS Berlin gemeinsam Seminare im Bereich Solar- und Batterietechnik anzubieten. Die ersten Seminare in diesem Jahr finden in Berlin statt. Der fünftägige Kurs DGS/VDE-Fachkraft Photovoltaik beginnt am 13.Februar. Der dreitägige Kurs DGS/VDE-Fachkraft Elektrische Energiespeicher startet am 1. März. Weitere Seminare finden im Mai und September in München und Offenbach statt. Die Seminare befähigen Elektrofachkräfte, Techniker und Ingenieure PV-Anlagen bzw. Batteriespeicher fachgerecht und VDE-Regel- konform auf hohem Qualitätsniveau zu planen, zu errichten, in Betrieb zu nehmen und zu betreiben. Nach erfolgreichem Bestehen der schriftlichen Prüfung erhalten die Teilnehmer das anerkannte DGS-VDE-Zertifikat.
DGS/VDE-Fachkraft Photovoltaik
Das Seminar mit Abschlussprüfung richtet sich an alle, die im Bereich Planung, Bau und Installation von PV-Anlagen tätig sind. Inhalte sind Grundlagen und Praxis auf dem neuesten Entwicklungsstand der Photovoltaik unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Technik, der geltenden Normen, Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen.
Die Planung von PV-Anlagen erfordert ein vielfältiges Wissen. Dazu zählen unter anderem Kenntnis über die Einstrahlung, Energiemanagementsysteme, PV-Komponenten und Speichermöglichkeiten. Im Blickpunkt stehen Optimierungsstrategien, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, aktuellen Marktdaten und Investitionskosten sowie die ökologische Bewertung, Ertragsermittlung und Ermittlung der Performance Ratio. Ausführlich wird auf die Dimensionierung von PV-Generator und Wechselrichter sowie der anderen Komponenten eingegangen. Schwerpunkte des Seminars sind weiterhin die Auswahl, Auslegung und Installation von Kabeln und Leitungen sowie der DC-/AC-Schutzelemente, einzuhaltenden Isolationswiderstände, Blitz- und Überspannungsschutz. Netzintegration (Spannungshaltung, Blindleistungs- und Frequenzregelung) und Netzanschluss unter Berücksichtigung der EEG-Anforderung, der FNN-Niederspannungsanwendungsregel und der Mittelspannungsrichtlinie werden in dem Seminar vermittelt. Im Praxisteil werden Messung und Prüfungen sowie die sichere Montage geübt. Die vermittelte Herangehensweise ist die Basis für eine effektive Projektabwicklung.
Weitere Informationen und Termine des Seminars finden Sie hier
DGS/VDE-Fachkraft Elektrische Energiespeicher
Das Seminar mit Abschlussprüfung richtet sich an alle, die im Bereich Planung, Bau und Installation von elektrischen Energiespeicheranlagen im Niederspannungsnetz in Kombination mit PV-Anlagen tätig sind. Inhalte sind Grundlagen und Praxis auf dem neuesten Entwicklungsstand der Batterie- und Speichertechnik unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Technik, der geltenden Normen, Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen.
Es wird die wirtschaftliche und technische Dimensionierung und Installation von netzgekoppelten PV-Anlagen plus Batteriespeicher mit dem Schwerpunkt Eigenverbrauch im häuslichen und gewerblichen Bereich behandelt. Dazu gehören die aktuelle Förderung, theoretische Grundlagen und praktische Integration von Energiespeichern. Thematisiert wird zudem die Einbindung von Speichern in bestehende Systeme. Grundlagen und Zusammenhänge von Lastmanagement und Energiespeicherung werden ausführlich erläutert. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten die Lastkurve mit Hilfe von Energiemanagementsystemen an die Erzeugungskurve anzupassen und wie eine gute Performance der Speichersysteme erreicht wird. Darüber hinaus wird die Auslegung in Bezug auf die Optimierung des Eigenverbrauchs sowie Aspekte der Netzintegration beleuchtet (gemäß EEG-Einspeisemanagement, FNN-Hinweispapier). Die normativen Anforderungen insbesondere der VDE 2510-2 sowie DIN EN 50272-2 an die Installation, den elektrischen Anschluss sowie an den Standort und die Sicherheit werden vermittelt. Das Thema Sicherheit bei Auslegung, Installation und Bau sowie Betrieb wird der Wichtigkeit des Themas angemessen, vertieft vermittelt. Dabei wird auch auf aktuelle Veröffentlichungen, bauliche und Brandschutz- Anforderungen, Störungen, Fehlersuche, Recycling und ökologische Bewertung eingegangen.
Die Teilnehmer erhalten das nötige KnowHow um Energiespeicher fachgerecht, sicher und wirtschaftlich zu planen, installieren und betreiben. Die Dozenten sind in den entsprechenden Normungs- und Richtliniengremien aktiv und arbeiten in einem praxisnahen Forschungsprojekt zur Speichersicherheit mit.
Weitere Informationen und Termine des Seminars finden Sie hier
13.01.2017
Apres Paris: eBooks funktionieren überall ganz einfach!
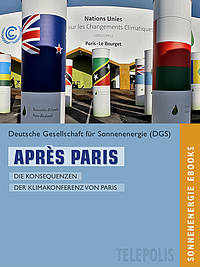
Noch wissen wir nicht, wie oft unser erstes eBook erworben wurde, jedoch haben wir in unserem unmittelbaren Umfeld festgestellt, dass es offensichtlich noch größere Hemmschwellen dieses Format betreffend gibt. Auch wir haben mit diesem eBook Neuland betreten, keiner der Beteiligten hatte großartig Erfahrung mit diesem Medium. Das war auch ein Grund dafür mit dem Heise-Verlag zu kooperieren. Das hat uns viel Arbeit erspart, hilft uns eine breitere Leserschaft zu finden und lässt uns sicher sein, dass unser eBook professionell erstellt wurde.
Damit sind wir auch schon bei dem Format und der Benutzung eines eBooks. Es ist eigentlich immer das gleiche, ob es nun als e-Book, e-Buch oder Digitalbuch angeboten wird. Je nach Anbieter gibt es Software um das eBook lesen zu können. Eine spezielle Hardware, sprich ein Lesegerät ist nicht zwingend nötig. Die elektronischen Bücher, sprich Bücher in digitaler Form, kann man mit Software, die es kostenfrei vom Anbieter der Computer-Betriebssystems (z.B. Windows oder Macintosh) gibt, lesen. Das gleiche gilt für Tablet-Computer oder Smartphones. Entscheidet man sich dazu vermehrt Bücher digital statt gedruckt zu lesen, ist es interessant sich einen E-Book-Reader anzuschaffen. Das bekannteste Produkt ist hier sicherlich der Kindle-Reader von Amazon.
Eine komfortable Eigenschaft von eBooks ist es, dass man stets, ob bei PC, Mac oder auch Lesegerät, die Schriftgröße an die unterschiedlichen Bildschirmgrößen und die eigenen Vorlieben anpassen kann. Es gibt somit kein Kleingedrucktes mehr. Auch können enthaltene Grafiken meist vergrößert dargestellt werden. Lediglich eBooks aus den Bereichen Kinderbücher, Sachbücher und Lehrbücher mit komplexem Layout, Animationen oder interaktiven Funktionen werden öfters mit festem Seitenlayout angeboten. Das meist verwendete eBook-Format ist im Übrigen der EPUB-Standard und nicht wie am Anfang oft noch verwendet das PDF-Format. Da das EPUB-Fomat auf Web-Standards aufbaut entspricht ein eBook in EPUB Format daher im Grundsatz einer speziell formatierten Website. Somit können eBooks auf Smartphones, Tablets oder Computern gleichermaßen benutzt werden.
Weitere optionale Funktionen von eBooks sind beispielsweise: Ein Zoom auf Vollformat, die Vollformatdarstellung, die Integration von Audio- und Video-Dateien, Animationen, Interaktive Funktionen wie auch eingebettete Vorlesefunktionen.
Hier geht es zu unserem eBook
13.01.2017
Einreichungen für den Intersolar AWARD und ees AWARD bis 17. März möglich!
Der Intersolar AWARD zeichnet 2017 bereits zum zehnten Mal in Folge innovative Lösungen der Solarwirtschaft aus – getreu dem Motto „Powering the Future with Innovation!“. Der branchenführende AWARD bietet seit Jahren Solarunternehmen eine einzigartige Plattform, um ihre Innovationskraft unter Beweis zu stellen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Durch den Intersolar AWARD erreichen herausragende Solarprojekte und bahnbrechende Technologien und Produkte ein breites Publikum. Somit zeichnet der Intersolar AWARD nicht nur Innovationen aus, sondern leistet auch einen zentralen Beitrag zum Wachstum der gesamten Branche.
Zum vierten Mal wird in diesem Jahr der ees AWARD für innovative Lösungen zur Speicherung elektrischer Energie vergeben – für eine saubere Energie der Zukunft. Die Bandbreite der Innovationen umfasst die gesamte Wertschöpfungskette innovativer Batterie- und Energiespeichertechnik – von Komponenten über die Fertigung bis hin zu konkreten Anwendungen und Geschäftsmodellen. Der Award bietet Energiespeicherfirmen eine professionelle Plattform, um ihre Errungenschaften und Innovationen zu präsentieren. Der ees AWARD – „Innovating Energy Storage!“
Unternehmen, die sich für den Intersolar AWARD und ees AWARD bewerben möchten, können bis 17. März 2017 ihre Unterlagen online einreichen. Für die Teilnahme zugelassen sind die Aussteller aller weltweiten Intersolar und ees Messen 2016.
Weitere Informationen: www.intersolarglobal.com/award und www.ees-events.com/award
Anmerkung: Die DGS ist Träger der Intersolar Europe
13.01.2017
Die unterschätzte Gefahr eines Versiegens des Golfstromsystems
(KlimaLounge) Eine neue Studie der renommierten Scripps Institution of Oceanography in San Diego und der University of Wisconsin-Madison hat bedeutende Implikationen für die künftige Stabilität des Golfstromsystems. Die Forscher um Wei Liu korrigierten den Süßwassereintrag in den Ozean in einem der gängigen globalen Klimamodelle (dem CCSM3 Modell des National Center for Atmospheric Research), um dort die beobachtete Salzkonzentration im Meerwasser besser wiederzugeben. Während im unkorrigierten Modell die Atlantikzirkulation recht stabil ist und sich als Reaktion auf eine CO2-Verdoppelung nur um rund 20% abschwächt, bricht sie in der korrigierten Modellversion zusammen. Erschienen ist die Arbeit in der Fachzeitschrift Science Advances, dem neuen Online-Ableger des Traditionsjournals Science.
Die mögliche Instabilität der Umwälzzelle im Atlantik (Atlantic Meridional Overturning Circulation oder AMOC – landläufig als Golfstromsystem bekannt) beschäftigt die Wissenschaft spätestens seit den 1980er Jahren, als Wallace Broecker in einem Aufsatz in Nature vor unangenehmen Überraschungen im Treibhaus warnte. Grund waren wachsende Hinweise auf abrupte Klimaänderungen in der Erdgeschichte aufgrund von Instabilitäten der Atlantikströmung.
Warum es einen Kipppunkt der Strömung gibt
Der grundlegende physikalische Mechanismus dieser Instabilität war bereits durch Henry Stommel im Jahr 1961 beschrieben worden. Zentral dafür ist der Süßwasserhaushalt (Niederschläge minus Verdunstung), der den Salzgehalt bestimmt. In den nördlichen Atlantik fließt ständig Süßwasser durch Niederschläge, Flüsse und Eisschmelze. Doch der Nachschub an salzreichem Wasser aus dem Süden, eben durch das Golfstromsystem, gleicht dies aus. Erlahmt dagegen die Strömung, dann kommt weniger Salznachschub, und an der Oberfläche sammelt sich zunehmend mit Süßwasser verdünntes Meerwasser. Das ist leichter als salzigeres Wasser und kann daher nicht so leicht in die Tiefe absinken. Da dieses Absinken – die sogenannte Tiefenwasserbildung – das Golfstromsystem antreibt, erlahmt die Strömung damit weiter. Es gibt einen kritischen Punkt, an dem dies zum unaufhaltsamen Teufelskreis wird. Dies ist einer der klassischen Kipppunkte im Klimasystem.
lesen Sie den hier den vollständigen Artikel von Stefan Rahmstorf










