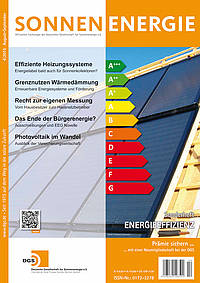05.08.2015
Sommerpause
Mit diesem Newsletter verabschieden wir uns in die Sommerpause. Die nächste Ausgabe wird erst wieder Anfang September erscheinen.
Wir wünschen allen unseren Lesern ein wenig Ruhe und Entspannung und viel Kraft in diesen energiepolitisch unruhigen Zeiten. Auch wir bei der Die DGS müssen mal Luft holen und können eine Pause gut gebrauchen.
Allen die noch eine spannende Lektüre suchen, sei diese Studie des VDE ans Herz gelegt: "Der Zellulare Ansatz"
05.08.2015
Baustein für Baustein
Bei der Umsetzung der Energiewende können wieder neue Rekorde vermeldet werden: Im ersten Halbjahr 2015 konnten in Deutschland dank höherer Windstromerzeugung über 30 Prozent des Stromverbrauches aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden. Auch hat Deutschland im gleichen Zeitraum 25 Terawattstunden (TWh) Strom, so viel wie noch nie, exportiert. Das sind etwa acht Prozent des von Januar bis Juni erzeugten Stroms. Im Vergleich: 2013 waren es 15 TWh, 2014 schon 19 TWh.
Doch wie kann das weitergehen? Sind deutlich größere Anteile möglich? Während das bei uns ein Konferenzthema der Netzbetreiber ist, ist es in unserer unmittelbaren Nachbarschaft einfach Realität: In Dänemark wurden am 9. Juli tagsüber 116 Prozent des Stromverbrauches aus Windkraft erzeugt. Der Überschuss wurde an Deutschland, Norwegen und Schweden exportiert. Als in der folgenden Nacht der Verbrauch sank, stieg der Windanteil auf 140 Prozent. Netzprobleme? Fehlanzeige. Also freie Bahn für noch mehr Erneuerbare Energie im Stromnetz, auch bei uns!
Im niedersächsischen Werlte hat Audi vor einiger Zeit eine Power-to-Gas-Anlage realisiert. Diese 6 MW-Anlage hat mittlerweile auch die Bestätigung des Netzbetreibers Tennet erhalten am Regelenergiemarkt teilzunehmen zu dürfen. Die Anlage muss dabei auf Anforderung bei Netzschwankungen innerhalb weniger Minuten mit Volllast bereitstehen und hilft dann, Frequenzschwankungen auszugleichen. Wieder ein Baustein mehr, die Erneuerbaren Energien in das Energiesystem zu integrieren. Einen ähnlichen Ansatz versuchen sogenannte Schwarmspeicherkonzepte. Mehrere im Schwarm vernetzte Speicher können ebenso als Regelenergie fungieren und Strom in das Netz einspeisen, wenn die stark schwankenden Energieträger Sonne oder Wind gerade nicht zur Verfügung stehen. Lange galt es als Problem der Erneuerbaren Grundlaststrom anbieten zu können. Mit sogenannten intelligent gesteuerten Kombikraftwerken ist dies jedoch bereits heute möglich. Solar-, Wind- und Biogaskraftwerke können schon jetzt einen Beitrag zur Systemstabilität leisten.
05.08.2015
Was kümmert mich die Resilienz von morgen
Die komplexen Zusammenhänge im Zuge der Energiewende zu begreifen maßen sich die wenigsten an. Trotzdem, oder gerade deshalb, bietet das Thema eine ideale Spielwiese für Politik und Interessenvertreter. Auch die Rahmenbedingungen passen dafür. Vielen von uns geht es sehr gut, Veränderungen sind momentan so unerwünscht wie selten zuvor. Die große Koalition, eigentlich eine unbeliebte Konstellation, wird dankbar angenommen. Skandale prallen ab und Reformwillen wird nicht eingefordert. So gab es erst kürzlich eine große angelegte Kampagne, die mutmaßte dass die Energiewende scheitern werde, würde man weitermachen mit „Subventionen und Begünstigungen für willkürlich ausgewählte Technologien“. Man müsse sich vielmehr um Marktwirtschaft und Wettbewerb zwischen den Erneuerbaren Energien kümmern, am besten sollte man einfach das EEG abschaffen. Das ist weder schlüssig und auch keine Lösung, nichts weiter als Populismus. Die Marktwirtschaft ist nun mal kein geeignetes Instrument für diese gesellschaftliche Aufgabe. Und das EEG? Das hat sich längst zu einer Beschäftigungsmaßnahme für Juristen entwickelt, es erfüllt seine Aufgabe, das Abbremsen der Energiewende bereits sehr gut. Mia san mia - der Teufel verrennt sich im Detail
Dem Volk nach dem Maul reden war schon immer eine erfolgversprechende Strategie der Politik. Mit der unübersichtlichen Energiewende und ihren zwangsläufigen Umwälzungen lässt sich gut arbeiten. Man muss dazu nur einen Teilbereich isoliert betrachten und das Ganze mit Regionalpatriotismus und einer Prise Angst vermischen. Schon hat man die Meinungshoheit auf Stammtischniveau erklommen.
Es liegt zwar in der Natur der Sache, bzw. der Personen, dass es bei Mandatsträgern oft an Verständnis für technische Details fehlt. Wenn aber Ministerien Entscheidungen vor allem im Austausch mit der Industrie treffen und Ansichten und Meinungen von Umfrage-Instituten ableiten, dann fehlt es am notwendigen breiten Dialog. Es ist nicht Aufgabe der Politik das große Ganze kleinzureden und Details zu diskutieren, sondern vielmehr die Chance zu nutzen einen breiten gesellschaftlichen Konsens anzustreben. Bei der Energiewende geht es ausnahmsweise nicht um regionale Interessen, sondern um langfristige, zukunftsweisende Entscheidungen. Lesen Sie hier weiter
05.08.2015
SONNENENERGIE 4/2015: Vom Hausbesitzer zum Hausnetzbetreiber
Teil 2: Von der Volleinspeisung zur Summenmessung: Selbst erzeugten Sonnenstrom nicht einfach in das Stromnetz einzuspeisen, sondern vorrangig selbst zu verbrauchen, ist für die Besitzer kleiner PV-Anlagen in den letzten Jahren zum Regelfall geworden. Seit sich eine Volleinspeisung kaum mehr lohnt, fragen sich Anlagenbesitzer aber auch zunehmend, wie sie ihren Strom zu anderen Verbrauchern im gleichen Gebäude oder sogar zu Nachbarhäusern leiten können. Der Aufwand, den PV-Anlagenbetreiber in diesem Zusammenhang auf sich nehmen, stieg in den letzten Jahren nicht nur aufgrund stetig sinkender Einspeisevergütungen, sondern auch aufgrund steigender Strompreise für Letztverbraucher.
Unerkannter Vorreiter
Noch weit niedriger als die Einspeisevergütung für PV-Strom ist allerdings seit jeher die Vergütung für Strom aus kleinen Blockheizkraftwerken (BHKW), wenn diese als hocheffiziente stromerzeugende Heizung in Wohngebäuden verwendet werden. Entsprechend dem 2002 in Kraft getretenen KWK-Gesetz ist die Einspeisevergütung für BHKW-Strom an den durchschnittlichen Börsenpreis für Grundlaststrom an der Strombörse aus dem vorangegangenen Quartal gekoppelt – derzeit 3,21 Cent je Kilowattstunde. Bedingt durch die noch wesentlich höhere Differenz zwischen Einspeisevergütung und Strombezugskosten wurden BHKWs im Wohngebäudebereich, anders als PV-Anlagen, von Anfang an für einen vorrangigen Eigenverbrauch eingesetzt und so setzte auch die Suche nach Möglichkeiten zum gemeinsamen Stromverbrauch aus Eigenerzeugungsanlagen wesentlich früher als bei PV-Anlagenbetreibern ein.
lesen Sie hier weiter
05.08.2015
SONNENENERGIE 4/2015: Ausschreibungen bald ohne Bürgerenergie?
Teil 2: Von der Volleinspeisung zur Summenmessung: Selbst erzeugten Sonnenstrom nicht einfach in das Stromnetz einzuspeisen, sondern vorrangig selbst zu verbrauchen, ist für die Besitzer kleiner PV-Anlagen in den letzten Jahren zum Regelfall geworden. Seit sich eine Volleinspeisung kaum mehr lohnt, fragen sich Anlagenbesitzer aber auch zunehmend, wie sie ihren Strom zu anderen Verbrauchern im gleichen Gebäude oder sogar zu Nachbarhäusern leiten können. Der Aufwand, den PV-Anlagenbetreiber in diesem Zusammenhang auf sich nehmen, stieg in den letzten Jahren nicht nur aufgrund stetig sinkender Einspeisevergütungen, sondern auch aufgrund steigender Strompreise für Letztverbraucher.
Unerkannter Vorreiter
Noch weit niedriger als die Einspeisevergütung für PV-Strom ist allerdings seit jeher die Vergütung für Strom aus kleinen Blockheizkraftwerken (BHKW), wenn diese als hocheffiziente stromerzeugende Heizung in Wohngebäuden verwendet werden. Entsprechend dem 2002 in Kraft getretenen KWK-Gesetz ist die Einspeisevergütung für BHKW-Strom an den durchschnittlichen Börsenpreis für Grundlaststrom an der Strombörse aus dem vorangegangenen Quartal gekoppelt – derzeit 3,21 Cent je Kilowattstunde. Bedingt durch die noch wesentlich höhere Differenz zwischen Einspeisevergütung und Strombezugskosten wurden BHKWs im Wohngebäudebereich, anders als PV-Anlagen, von Anfang an für einen vorrangigen Eigenverbrauch eingesetzt und so setzte auch die Suche nach Möglichkeiten zum gemeinsamen Stromverbrauch aus Eigenerzeugungsanlagen wesentlich früher als bei PV-Anlagenbetreibern ein.
lesen Sie hier weiter
05.08.2015
Primärregelleistung durch privat genutzte Schwarm-Stromspeicher
Am 20. Juli 2015 wurde erstmals ein Verbund privat genutzter Solarstromspeicher für die Erbringung von Primärregelleistung präqualifiziert. 65 Energie-Speicher-Systeme (ESS) des Pilotprojekts Swarm dürfen damit ab sofort zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen. Das Gemeinschaftsprojekt des Systemlieferanten Caterva GmbH und der N-Ergie Aktiengesellschaft wird vom Freistaat Bayern gefördert. Die Siemens AG ist Technologiepartner.
Die Besonderheit des virtuellen Großspeichers ist seine Zusammensetzung aus vernetzten, haushaltsgroßen Energiespeichern. Die ESS enthalten Lithium-Ionen-Akkus von Saft Batterien GmbH, die Leistungselektronik liefert Siemens. Jedes ESS verfügt über eine eigene Steuereinheit, so dass es autark auf die Netzfrequenz reagiert. Über das UMTS-Netz sind die in privaten Haushalten installierten Speicher mit der Leitzentrale bei Caterva verbunden und werden dort als Schwarm koordiniert. Die Leitzentrale nimmt die einzelnen aktuellen Speicherladestände der ESS auf und regelt den Schwarm so aus, dass jederzeit die angebotene Primärregelleistung zur Verfügung steht. An die Leitstelle der TenneT gibt sie online Daten weiter. Die Kraftwerksleitwarte der N-ERGIE übernimmt die Bedienung und Beobachtung des virtuellen Großspeichers rund um die Uhr, wie beim eigenen Kraftwerk.
Doppelnutzen für die Haushalte
Nutzer der von Caterva entwickelten ESS mit einer jeweiligen Gesamtleistung von 20 Kilowatt und einer Kapazität von 21 Kilowattstunden sind private Solaranlagenbetreiber, die dank der Speicher 60 bis 80 Prozent ihres Strombedarfs aus Eigenerzeugung decken können und gleichzeitig durch die Bereitstellung von Regelleistung einen Beitrag zur Energiewende leisten. Aufgrund der deutlich größeren Akkukapazität des ESS im Vergleich zu konventionellen Solarstromspeichern bedeutet die Teilnahme am Regelleistungsmarkt für die Haushalte keine Einschränkung bei der Nutzung des selbsterzeugten Stroms. Beitrag zur Netzstabilität
Mit der Bereitstellung von positiver und negativer Primärregelleistung trägt der Schwarm zur Netzstabilität bei. Regelleistung ist erforderlich, um die Abweichungen zwischen Stromerzeugung und -verbrauch so auszugleichen, dass die Netzfrequenz konstant bei 50 Hertz liegt. Sie wird von den Übertragungsnetzbetreibern in drei Produkten beschafft: Primär-, Sekundär- und Minutenregelleistung. Die Anforderungen an die Primärregelleistung sind am höchsten, da diese innerhalb von 30 Sekunden bereitzustellen ist: Vor der Sekundär- und Minutenregelleistung wird Primärregelleistung direkt proportional zur Abweichung der Netzfrequenz von jedem Energiespeichersystem erbracht.
05.08.2015
Vorankündigung: „DGS-Expertenforum: Direktvermarktung und Direktverbrauch“
Beim DGS-Expertenforum am 25.09.2015 erörtern renommierte Fachleute in Nürnberg die unterschiedlichen Ansätze für die Vermarktung von Solarstrom vor Ort und über das Netz: In drei moderiertem Gesprächsrunden werden die Möglichkeiten der geförderten Direktvermarktung, die Chancen des Ausschreibungsverfahrens, die Funktionsweise des Grünstrom-Markt-Modells und die Herausforderungen der sonstigen Direktvermarktung behandelt, ebenso wird der Direktverbrauch im Mehrfamilienhaus und Gewerbeareal diskutiert. Die Diskutanten - namhafte Juristen, Verbandsvertreter, Branchenkenner – stehen Rede und Antwort zu den aktuellen Themen des PV-Markts.
Gespräch 1: Geförderte Direktvermarktung und Ausschreibungsverfahren
- Dr. Steffen Herz, von Bredow Valentin Herz Rechtsanwälte
- Stefan Erbacher, buzzn GmbH
- Dr. Maria Hustavova, Naturstrom AG
- Dr. Fabian Sösemann, Grundgrün Energie GmbH
Gespräch 2: Grünstrom-Markt-Modell und sonstige Direktvermarktung
- Daniel Hölder, Clean Energy Sourcing AG
- André Beck, N-ERGIE Aktiengesellschaft
- Rene Groß, Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften (DGRV)
- Wolf von Fabeck, Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV)
Gespräch 3: Direktverbrauch im Mehrfamilienhaus und Gewerbeareal
- Peter Nümann, Nümann+Siebert Rechtsanwälte
- Nikolaus Starzacher, Discovergy GmbH
- Clemens Bloß, infra new energy GmbH
- Michael Vogtmann, DGS Franken
Hintergrund: Gewerbe- und Industriebetriebe, Stadtwerke, private Bauherren und Wohnungsgesellschaften zeigen heute verstärkt Interesse an Photovoltaikanlagen. Wie lassen sich diese unter den aktuellen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen realisieren?
Projektentwickler, Investoren und Planer stehen vor der Frage, welches Betreiberkonzept und welche Vermarktungsform macht wirklich Sinn: Was rechnet sich wirtschaftlich am besten? Welche technischen, rechtlichen und bürokratischen Hürden sind zu nehmen? Welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich? Vermarkte ich den Solarstrom meiner PV-Anlage über das öffentliche Netz oder gestalte ich eine Direktabnahme vor Ort? Worauf ist zu achten?
Das Ausschreibungsverfahren für Dach- und Freiflächenanlagen, das Grünstrom-Markt-Modell, der Direktverbrauch im Mehrfamilienhaus und Gewerbeareal werden auf ihre grundlegende Funktionsweise, ihre Vor- und Nachteile hinterfragt, um Orientierung und Hilfestellung für Ihre Entwicklung und Investition in neue Projekte zu liefern.
Hinweis: Fragen an die Experten können von Teilnehmer bereits vorab bei DGS Franken eingereicht werden: info(at)dgs-franken.de
Weitere Infos und Buchung:
www.solarakademie-franken.de/termine/SP13-2015-09-25
05.08.2015
Unterstützen Sie die DGS
Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie ist als gemeinnütziger Verein berechtigt, Spenden anzunehmen und im Sinne des Gesetzes Spendenbescheinigungen auszustellen.
Sollten Sie unsere Vereinsarbeit für finanziell unterstützenswert halten, können Sie dies einmalig oder im Rahmen einer längeren projektgebundenen Förderung tun. Bei Interesse an Projektpatenschaften oder einer Kampagnenförderung für Erneuerbare Energien wenden Sie sich bitte an:
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.
Bernhard Weyres-Borchert
Tel.: 030/29381260
praesidium(at)dgs.de
Sie können gerne auch direkt an die DGS spenden:
Bank für Sozialwirtschaft
Kto-Nr. 8807400 (IBAN: DE88700205000008807400)
BLZ: 700 205 00 (BIC: BFSWDE33MUE)
Verwendungszweck "Spende"
Mitgliedschaft:
Durch Ihre Mitgliedschaft in der DGS unterstützen Sie unsere Arbeit für eine ökologische und sozialverträgliche Energiewende. Als Neumitglied oder Werber eines Neumitglieds der DGS belohnen wir Sie zu Beginn mit einem Einstiegsgeschenk. Informieren Sie sich über die zahlreichen Vorteile einer Mitgliedschaft.