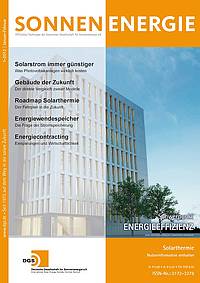20.01.2012
SONNENENERGIE 1/2012: Vergleich zweier Gebäudekonzepte
Anlässlich eines Berichts in der SONNENENERGIE, Ausgabe 11/03 kam es zu der Anregung, einen Vergleich zweier Konzepte aus dem Bereich des solaren Bauen zu veröffentlichen. In der aktuellen SONNENENERGIE boten wir den durchaus konträre Konzepten von Prof. Fisch und Prof. Leukefeld einen Rahmen, ihre Vorstellung eines Gebäudes der Zukunft, oder vielmehr der Gegenwart vorzustellen.
Die beiden Artikel sollten nach Möglichkeit vergleichbar sein, Umfang und Inhalt wurden von der Redaktion der SONNENENERGIE vorgegeben. Eine Vorgabe war zudem, dass bestimmte Grundinformationen enthalten waren, um den Lesern die unterschiedliche Herangehensweisen bzw. Konzepte für Gebäude mit hohem Anteil an Eigenstromerzeugung bzw. Eigenenergieversorgung differenzierter beurteilen zu lassen. Die zweiseitigen Textes sollten folgende Informationen enthalten:
- Gebäudeeckdaten (Wohnfläche, Nutzfläche nach EnEV, HT`nach EnEV, U Werte Aussenwand, Dach, Verglasung, KfW Status etc.)
- spezifischer Heizenergiebedarf (kWh/m²a) und Primärenergiebedarf (kWh/m²a) nach EnEV und prognostizierte jährliche Energiekkosten pro m2 wfl (aufgeteilt nach Heizung/WW und Haushaltsstrom
- Technische Umsetzung der Raumwärmeunterstützung, kurze Technikbeschreibung (Wärme, Strom, Lüftung)
- Bemessungsgrundlage des Trinkwasserbedarfs, technische Umsetzung der Trinkwarmwasserbereitung
- elektrische Verbraucher im Gebäude (inkl. Regelung, Steuerung, Pumpen...) mit/ohne Elektromobilität, welcher Strombedarf wird hier zugrunde gelegt
- Solarstrom: gibt es Überschüsse, wenn ja in welchen Umfang und zu welchem Zeitpunkt, gibt es Autarkie (teilweise oder komplett), sind Einnahmen durch Einspeisevergütung eingeplant, wie hoch ist die solare Deckung (Strom bzw. Wärme)
- Gibt es Erfahrungswerte aus den ersten Jahren (Messwerte) und in welchem Verhältnis stehen diese zu den prognostizierten Daten.
- Gab es technische Entwicklungen / Innovationen beim Bau und der Planung
- Wie individuell sind die Gebäude, sind es Unikate oder kann man schon von Prototypen oder Serienreife sprechen
- Wie hoch sind die Gesamtkosten (ohne Grundstück), welche Förderungen sind hierbei eingeplant – Bei den Kosten sollte nach den KG 300 und 400 sowie den Planungskosten unterschieden werden
Diese Vorgaben wurden weitestgehend eingehalten, die beiden Artikel finden Sie hier im Nachgang.
20.01.2012
SONNENENERGIE 1/2012: Gebäude der Zukunft (I)
Teil I des Vergleichs – Energieautarkes Haus + Elektromoblität
Neben der Energieversorgung steht in Zeiten der Energiewende ebenso der Energieverbrauch in der Diskussion. Der Energiebedarf unseres täglichen Lebens spiegelt sich nicht zuletzt in unseren Gebäuden wieder. Neben der energetischen Sanierung von Altbauten stehen gerade neue Gebäudekonzepte für den Wandel unserer Zeit. War das Haus von gestern Energieverbraucher, Wärme und Strom mussten in das System Haus von außerhalb eingebracht werden, so erzeugt es heute seinen Energiebedarf selbst, bisweilen werden sogar Überschüsse erwirtschaftet. Dieser Artikel beleuchtet den Weg zu Gebäuden mit hoher und intelligenter Eigenversorgung mit Strom und Wärme aus der Sonne bis hin zu energieautarken Gebäuden, die mittlerweile keine Utopie mehr sind.
Strom heute: zu kostbar zum Heizen
Das energieautarke Haus basiert auf dem Standard des Sonnenhaus-Instituts. Diese sogenannten Sonnenhäuser mit über 50 Prozent solarthermischer Deckung für Heizung und Warmwasser sind bezüglich Primärenergiebedarf (5–15 kWh/m2a), CO2 Ausstoß und jährlichen Heizkosten die derzeit sparsamsten Häuser am Markt und erfreuen sich steigender Beliebtheit. Über 1000 solcher Sonnenhäuser wurden in Deutschland in den letzten Jahren errichtet. Der Sonnenhausstandard mit Langzeitwärmespeichern ist somit ein bewährtes und zunehmend marktverbreitendes Konzept. Die Sonderform des energieautarken Haus hat als serienreifes Gebäude zudem auch den Status des Prototyps längst abgestreift. Seinen Bedarf an Heizung und Warmwasser deckt es weitestgehend mit der Sonne. Dafür ist es mit einem 9 m³ Langzeitwärmespeicher (Wasser) und 46 m2 Kollektorfläche ausgestattet. Der zusätzliche Wärmebedarf wird mit einem hocheffizienten Kaminofen und etwa 1–2 fm Stückholz (für etwa 75–150 €) pro Jahr gedeckt. Die Trinkwassererwärmung erfolgt mittels Frischwasserstation im Durchflussprinzip. Dabei wird nur die jeweils benötigte Menge an Wasser hygienisch erwärmt. Das spart jede Menge Energie und verhindert zudem die Legionellenbildung. Um auch in den Zeiten mit hohem Energiebedarf und tief stehender Sonne diese optimal nutzen zu können ist die Dachfläche bewusst auf 45° geneigt. So wird auch im Herbst, Winter und Frühjahr genügend und im Sommer nicht zu viel Überschuss produziert, womit auch das Netz entlastet wird. Der Primärenergieverbrauch liegt bei 5 kWh/m2a und damit etwa 90 Prozent unter einem Standard EnEV 2009 Einfamilienhaus und etwa 80 Prozent unter einem typischen Standard Passiv- oder Plusenergiehaus.
20.01.2012
SONNENENERGIE 1/2012: Gebäude der Zukunft (II)
Teil II des Vergleichs – Netto-Plusenergie-Gebäude mit Elektromobilität
Die Planung und Realisierung zukunftsorientierter Gebäude setzt voraus, dass in einem integralen Team aus Architekten und Ingenieuren, Energieeffizienz, Komfort und Umweltverträglichkeit zum Maßstab des gesamten Prozesses werden. Vom Konzept bis zum Inbetriebnahme gilt es energetische Anforderungen und gestalterische Zielsetzungen zu entwickeln und zu verfolgen. Das ist der Anspruch, mit dem das Netto-Plusenergie- Gebäude mit Elektromobilität Berghalde als reines „Stromhaus“ umgesetzt wurde.
In einer ganzheitlichen Gebäudebilanz werden neben der notwendigen Heizwärme, der gesamte Strombedarf für den Anlagenbetrieb und den Haushalt und der Energieaufwand für die private Mobilität berücksichtigt und regenerativ gedeckt. Für den erweiterten Fokus sind als besondere Herausforderung die Schnittstellen zwischen der solaren Stromerzeugung und den Stromverbrauchern im Haus und der E-Mobilität und zwischen der Gebäudetechnik und der netzgebundenen Infrastruktur zu lösen.
Architektur
Die Randbedingungen sind eine Südhanglage und ein 900 m² großes Grundstück, die Anforderungen lauten hoher architektonischer Anspruch maximale Energieeffizienz und bilanzieller Überschuss aus regenerativen Energien bei hervorragendem Wohnkomfort. Der Neubau folgt der Form der Topographie, gräbt sich auf der Nordseite in den Hang ein und bietet mit einem schlichten Pultdach parallel zur Geländeneigung die ideale Voraussetzung für die Integration aktiver Solarenergiesysteme. Das Gebäudekonzept wird damit integraler und formgebender Bestandteil der Architektur. Eine einfache, geometrische Formensprache setzt sich im Innenraum bis zur Planung von Einbaumöbeln fort und wird durch die reduzierter Material und Farbwahl unterstützt. Bis ins Detail werden bauphysikalische Vorgaben nach reduzierten Verlusten und dem Schutz vor sommerlicher Überhitzung in Einklang gebracht mit den ästhetischen Anforderungen. Über großzügige südorientierte Fensterflächen nutzen die Wohnräume Tageslicht sowie passiv solare Gewinne und lassen die Blickbeziehungen ins Tal raumbestimmend werden. Nord-, Ost- und Westfassaden sind geschlossener gehalten und nehmen in dem zonierten Baukörper Schlaf- und Nebenräume auf.
20.01.2012
Baustoffe der Zukunft am 25.01. in München
Am Mittwoch, den 25. Januar findet im Bauzentrum München, in der Wiily-Brandt-Allee 10, ab 08:45 Uhr das Fachforum "Baustoffe der Zukunft: Einsatz von Recycling-Baustoffen, Potenziale erneuerbarer Rohstoffe" statt. Die DGS ist Kooperationspartner der Veranstaltung und hat die fachliche Leitung bei der Vorbereitung dieses Fachforums.
Jetzt wird es ernst, die vorhergesagten Szenarien zur Rohstoff-Knappheit werden zunehmend Realität. Ständige Preiskorrekturen bei Bauprodukten spiegeln die zunehmenden Engpässe in der Rohstoffversorgung wieder. Immer mehr Investorinnen und Investoren verlangen daher eine Antwort auf diese Kosten-Unsicherheit, besonders auch hinsichtlich größerer Entsorgungs-Mengen bei derSanierung. Es stellt sich die Frage, wie im Baualltag die Materialien über den gesamten Lebenszyklus hinweg – also von der Gewinnung bis zur Entsorgung – effizienter genutzt werden können.
Die Fragestellung der Ressourcen-Effizienz ist für Baustoffe jeglicher Herkunft relevant – auch bei Materialien aus erneuerbaren Rohstoffquellen. Durch die Kreislaufwirtschaft mit der Umwandlung von Bauabfällen, Bauteilen und Abbruchmaterialien in neue Baustoffe und durch deren Wiederverwendung können die natürlichen Rohstoff- Ressourcen geschont werden.
Unsere neue Forums-Reihe „Knappe Rohstoffe – Ressourcen-Effizienz“ zeigt den Stand der Diskussion auf und beleuchtet auch die Chancen und Grenzen der Wiederverwertbarkeitvon Rohstoffen und Materialien.
Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten:
Bauzentrum München
Willy-Brandt-Allee 10, 81829 München
Telefon: (089) 54 63 66 - 0, Fax: (089) 54 63 66 - 20
E-Mail: bauzentrum.rgu(at)muenchen.de
www.muenchen.de/bauzentrum