Ein Meinungsbeitrag von Götz Warnke
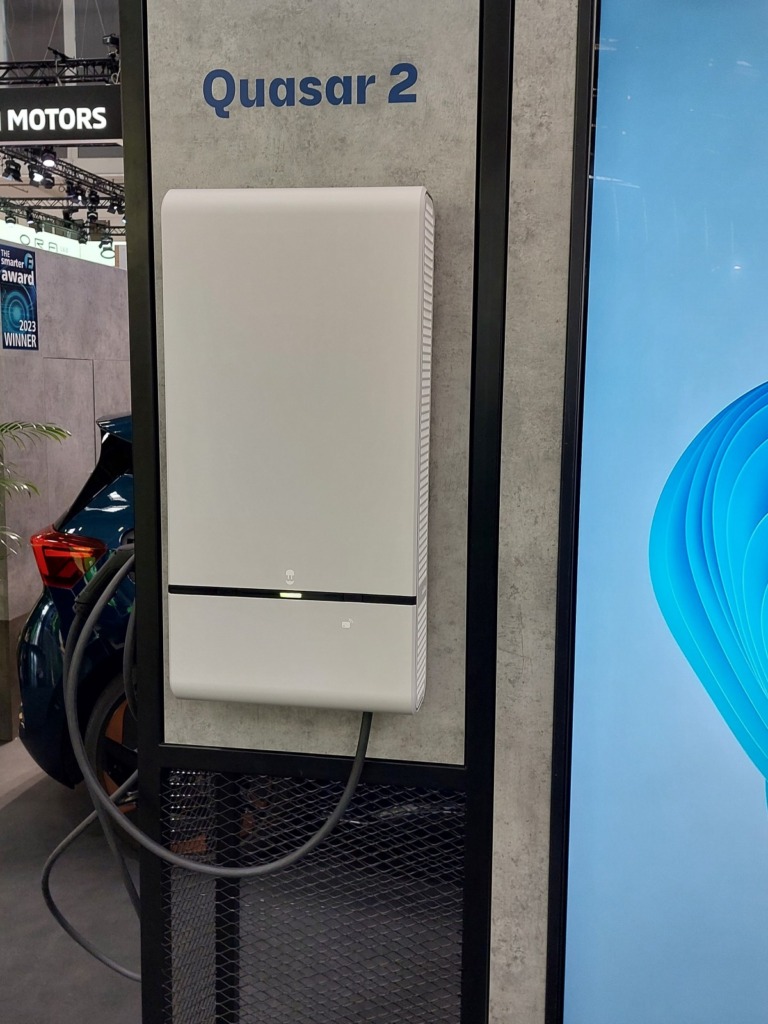
Während in der vergangenen Woche die Automesse IAA Mobility in München lief, beglückte uns der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am 12.09. mit einer Pressemitteilung (362/25), die sich gegen das – angebliche – „Verbrennerverbot“ in der EU ab 2035 richtete: dieses sei ideologisch und müsse gekippt werden. Schließlich sei der Strommix in Deutschland alles andere als klimaneutral. Und vor allem hinsichtlich der Batterie gelte: „100 Prozent Elektromobilität heißt auch 100 Prozent Abhängigkeit von China – Frau von der Leyen muss sich bewegen“. Statt des umstrittenen Verbrennerverbots brauche es Technologieoffenheit, statt „der aktuellen Green Deal-Planwirtschaft“ brauche es bewährte Marktwirtschaft.
Soweit, so schlicht. Denn deutlich wird durch diese Pressemitteilung vor allem eins: der bayerische Wirtschaftsminister ist nicht „die hellste Lampe bei der Auto-Beleuchung“:
Erstens gibt es überhaupt kein Verbrennerverbot oder Verbrenner-Aus! Auch ab 2035 werden bereits zuvor zugelassene Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiter gefahren und auch weiter als Gebrauchtwagen verkauft werden können. Ja, sogar neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor könnten hinzukommen, die allerdings ausschließlich mit Wasserstoff oder wohl auch E-Fuels betrieben werden können. Verboten sind dann nur Neuwagen, die auf Fossilkraftstoffe angewiesen sind. Aber ein „Fossilkraftstoff-Verbrennerverbot“ klingt nun mal weniger dramatisch und nach Aufmerksamkeit heischend als ein „Verbrennerverbot“
Zweitens gibt es keine Technologieoffenheit jenseits der Regeln der Physik: die Erderhitzung ist ebenso wie die Schwerkraft keine Glaubensangelegenheit, sondern eine physikalische Tatsache. Dass der CO2-Ausstoß des Autoverkehrs die Erderhitzung befeuert, ebenfalls. Und dass das batteriebetriebene E-Auto weniger Energie zehrende Umwandlungsschritte beim Strom benötigt und daher effizienter ist als das mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Auto oder als Verbrennerfahrzeuge – ganz gleich, mit welchem Treibstoff – , ist auch physikalisch eindeutig. Das mag einem gefallen oder nicht, aber man sollte nicht versuchen, die Tatsachen zu verdrehen. Zumal manche der vorgeblichen Technikalternativen wie die Plug-In-Hybride im Alltag deutlich dreckiger sind als auf dem Prüfstand.
Drittens ist der Verweis auf den deutschen Strommix eine Halbwahrheit. Denn die meisten deutschen E-Auto-Besitzer laden zu Hause, und viele davon haben einen Ökostrom-Tarif, manche sogar noch eine PV-Anlage zusätzlich. Solche E-Autos fahren heute schon sauber, ganz gleich, wie der deutsche Strommix aussieht. Und da der deutsche Strommix immer weniger CO2-lastig wird, werden selbst solche E-Autos immer sauberer, die nicht zu Hause laden.
Viertens gibt es auch bei 100 Prozent Elektromobilität keine 100 Prozent Abhängigkeit von China. Denn neben den chinesischen Batterieriesen BYD und Catl gehören weiterhin LG und Samsung aus Korea sowie Panasonic aus Japan zu den 10 größten Batterieherstellern der Welt. Dazu kommen weltweite Bestrebungen zum Recycling der Auto-Akkus – auch in Europa – , welche die China-Abhängigkeiten reduzieren werden. Last but not least: Würde man nicht ständig das E-Auto schlecht reden, sondern statt dessen die Milliarden der Subventionen von fossilen Treibstoffen in die E-Mobilität stecken, gäbe es in Deutschland längst große Batteriefabriken. Dagegen hat man mit der bisherigen Politik sogar einen chinesischen Batteriehersteller aus dem Land getrieben.
Leider steht Hubert Aiwanger mit solchen Positionen nicht allein. Mit dabei sind u.a. sein kongenialer Ministerpräsident Markus Söder und Manfred Weber, der Chef der Konservativen im EU-Parlament. Und natürlich gibt es weitere konservative Mobilitäts-Populisten, von den extrem rechten ganz zu schweigen. Sie alle bedienen die große, meist ältere Wählergruppe der deutschen Spießbürger, die in ihren seit mindestens 20 Jahren unveränderten Wohnzimmern sitzen, nebenan in der Garage einen glänzend polierten Stern aus Stuttgart stehen haben – natürlich Verbrenner! – , und denen selbst nie ein Licht aufgeht, dass eine zunehmend enger werdende Welt sich ändert, ja ändern muss. Vielmehr wird diese Kukident- und Du-darfst-Fraktion („Ich will so bleiben wie ich bin“) in ihrer Ignoranz durch solche Populisten noch bestärkt. Kein Wunder, dass das Vertrauen der Menschen in Politiker nur bei 11 Prozent liegt – und damit wohl nicht mehr allzu weit von Hütchenspielern entfernt.
Die „Partituren“ für das Orchester der Populisten werden geschrieben von der Industrie, in diesem Fall der Automobil- und Zuliefer-Industrie, und speziell auch von den entsprechenden europäischen Verbänden ACEA und CLEPA. Und selbstverständlich äußern sich jede Menge „Top-Manager“ aus den entsprechenden Unternehmen, fast ausschließlich für ein Aus bzw. eine Aufweichung des Fossiltreibstoff-Verbrenner-Neuwagen-Zulassungs-Aus 2035. Solches ist bei den Zulieferern z.B. von Bosch – der Firma, die seinerzeit in den Abgas-/Diesel-Skandal verwickelt war – oder der Continental-Ausgründung Aumovio SE zu beobachten. Vor allem aber kommen die Aufweichungs-Forderungen von den Managern der Autohersteller. Ja, das Jammern gehört zum Top-Manager-Handwerk, und es gibt auch Spitzenmanager von Tesla oder Audi, die mit guten Gründen gegen eine Aufweichung der EU-Regeln für 2035 sind. Dennoch ist die Haltung der Mehrheit der Manager auch abseits des Themas Klimakrise völlig unverständlich:
Erstens ist es für Autohersteller eine große finanzielle Herausforderung, neben den neuen E-Autos und in Konkurrenz zu den innovativen Chinesen auch noch die strukturell völlig anders aufgebauten Fossil-Fahrzeuge/Verbrenner weiter zu entwickeln.
Zweitens zeigen sich die europäischen wie deutschen E-Auto-Hersteller mit ihren Produkten derzeit sehr innovativ, technisch zuverlässig und gegenüber chinesischen Konkurrenz am Markt erfolgreich. Zudem gibt es in Europa mittlerweile auch günstige E-Autos von den Konzernen PSA, Renault/Dacia und Stellantis. Jetzt die Verkehrswende hin zum E-Auto zu bremsen, ergibt keinen Sinn.
Drittens zeigt eine bereits im Februar diesen Jahres erschienene Analyse eines internationalen Wissenschaftlerteams: „Der Verbrennerausstieg stärkt die europäische Automobilindustrie. Er bringt strategische Klarheit, vermeidet Fehlinvestitionen und erleichtert Innovation.“
Viertens hatten sich zur UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow (COP 26) verschiedene Autohersteller zum „Verbrenner-Aus“ 2035 in der EU bekannt. Nachdem schon zuvor VW dieses Ziel bestätigt hatte, kamen nun die Marken Volvo, BYD, Jaguar Land Rover, Ford, General Motors (GM) sowie Mercedes-Benz hinzu. Jawohl, auch Mercedes-Benz, dessen Chef Ola Källenius als Präsident des ACEA heute mehr Flexibilität hinsichtlich des Endes des fossilbetriebenen Verbrenners fordert. Übrigens: 2021 hieß der Chef bei Mercedes-Benz – Ola Källenius!
Man kann sich also schon fragen, ob das Führungspotential der Autoindustrie an kollektiver Amnesie leidet. Oder arbeiten diese „Top-Manager“ etwa mit an einer Neuauflage des Buches „Nieten in Nadelstreifen“?
Angesichts der Kakophonie der industriellen Interessenvertreter und Politiker stellt sich die Frage: was nun?
Die sinnvollste Antwort darauf lautet: das „Verbrenner-Aus“ auf 2030 vorziehen!
Denn eine breite E-Auto-Palette ist in Europa bereits vorhanden und wird bis 2030 noch breiter werden – gerade auch im unteren Preissegment.
Der derzeit bestehende Überschuss an E-Ladesäulen ermöglicht – bei kontinuierlichem Ausbau – schon heute einen Hochlauf der Emobilität.
Eine schnelle Verkehrswende bringt Klarheit für den Markt; sie verhindert Fehlinvestitionen (s.o) und schafft für Industrie Verlässlichkeit.
Ein solches Nahziel belohnt Innovationen und sichert Arbeitsplätze, auch wenn sich morgen der Arbeitgeber oder nur der Firmenname ändern mag.
Der schnelle Umstieg auf Elektromobilität verhindert, dass China Europa bei strategisch wichtigen Segmenten wie der Batterieherstellung endgültig enteilt.
Das Ziel 2030 nimmt das heutige Management in die Verantwortung für die Verkehrswende und verhindert, dass man lieber heute schöne Quartalszahlen liefert, und die absehbaren Probleme eines Weiter-So seinen Nachfolgern überlässt.
Worauf warten wir eigentlich noch?
