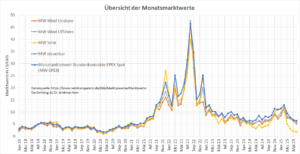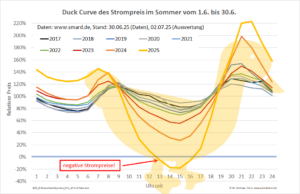Anmeldung zum kostenfreien
DGS-Newsletter
Hier können Sie sich für die kostenfreien DGS News an- bzw. abmelden.
Mit den kostenfreien DGS-News werden Sie regelmäßig von der DGS-Online-Redaktion über die aktuellen Ereignisse rund um Solarenergie und Erneuerbare Energien unterrichtet.
Bitte tragen Sie sich hier mit Ihrer Emailadresse ein, um die ausgewählten DGS News ab sofort einmal wöchentlich zu erhalten. Die News enthält redaktionelle Informationen und gelegentlich Werbung zu Themen der DGS und Erneuerbarer Energien.
Wichtig: Bitte prüfen Sie nach dem Anmeldevorgang Ihr Email-Postfach und klicken Sie auf den Bestätigungslink in der Email, die Sie von uns bekommen.
Bitte geben Sie nur eine eigene Email-Adresse ein oder die Adresse von Personen, bei denen Sie sicher sind, dass diese einverstanden sind. Wenn die Anmeldung nicht binnen einer Woche bestätigt wird, werden die eingegebenen Informationen binnen einer weiteren Woche gelöscht.
Mit der Anmeldung zu den News erteilen Sie eine Einwilligung in die Speicherung der eingegebenen Daten zum Zweck der Übersendung der Bestätigungs-Email an die angegebene Adresse, mit der wir die Email-Adresse und das Einverständnis des Empfängers prüfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Wir betrachten die Einwilligung als widerrufen, wenn die Bestätigung nicht erfolgt. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.
Bitte beachten Sie, dass wir die IP-Adressen und den Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung speichern, um die Einwilligung nachweisen und möglichem Missbrauch nachgehen zu können. Die Informationen werden solange gespeichert, wie die News abonniert bleibt. Rechtsgrundlagen insoweit sind Art. 6 Abs. 1 c) und f) DSGVO.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) e.V., EUREF-Campus 16, 10829 Berlin, Tel. 030 / 58 58 238 – 00, Email: info@dgs.de. Ab dem 5.3.2025 verarbeiten wir die Daten der Newsletter-Abonnenten auf den Servern der SEWOBE AG.
Die Webseite der SEWOBE AG finden Sie hier: https://www.sewobe.de/ueber-uns/
Sie haben dem Verantwortlichen gegenüber ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit nach Maßgabe der DSGVO sowie ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde.