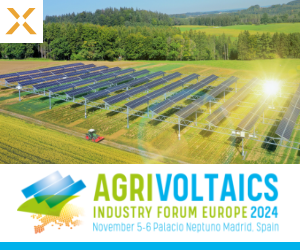18.11.2022
Befristeter Weiterbetrieb geplant: Abstimmung im Bundestag über Atomgesetz
Ein Bericht von Tatiana Abarzúa
Bislang galt es fraktionsübergreifend als beschlossene Sache, dass Deutschland 2022 die letzten AKWs vom Netz nimmt: die Druckwasser-Reaktoren Isar-2 in Bayern, Neckarwestheim-2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Nach geltender Rechtslage läuft ihre Betriebserlaubnis am 31. Dezember 2022 aus. Am Freitag stimmten die Bundestagsabgeordneten über eine Änderung des Atomgesetzes ab, um einen Streckbetrieb dieser drei verbleibenden Reaktoren zu ermöglichen.
Abstimmung über Gesetzentwurf der Bundesregierung
Im Gesetzentwurf der Bundesregierung ist ein befristeter Weiterbetrieb der AKW bis zum 15. April 2023 vorgesehen und die Anschaffung neuer Brennstäbe explizit ausgeschlossen. Begründet wird diese Gesetzesänderung für einen Streckbetrieb mit der Haltung von Erzeugungskapazitäten im deutschen Stromnetz, einen positiven Beitrag zur Energieversorgungsicherheit, zur Leistungsbilanz und zur Netzsicherheit.
Erst zwei Tage zuvor fand die Anhörung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages statt. Der Bundestag hat sich in einem Schnellverfahren mit der Gesetzesnovelle befasst. Für die Annahme des Gesetzes waren 369 Stimmen nötig gewesen. 375 Abgeordnete stimmten dafür. 216 stimmten dagegen; unter anderem die Fraktionen der CDU/CSU und die Linke. 70 enthielten sich (siehe Abbildung).
Seit Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt hatte, zwei dieser Reaktoren im Streckbetrieb bis Mitte April 2023 laufen zulassen, wird der Atomausstieg von vielen Politiker:innen und Lobbyst:innen öffentlich wieder in Frage gestellt. Ein Beispiel dafür ist der Gesetzesvorschlag der Unionsfraktion, der eine Laufzeitverlängerung bis mindestens Ende 2024 fordert. In der Anhörung im Umweltausschuss hatte die Rechtsanwältin Dörte Fouquet darauf hingewiesen, dass ein solcher Weiterbetrieb über den 15. April 2023 hinaus eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfordere. Das habe ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu Laufzeitverlängerungen der belgischen Kraftwerke Doel 1 und Doel 2 gezeigt.
Stimmen in der Debatte
Als einzige Fraktion hatte die Linke gegen die Novelle gestimmt. In seiner Rede fasste MdB Ralph Lenkert elf Gründe zusammen, warum seine Fraktion „jeden Betrieb von Atomkraftwerken“ ablehnt. Die Argumente lauten: menschliches Versagen beim Betrieb ist immer möglich, Naturkatastrophen mit bester Technik nicht immer beherrschbar und Terrorangriffe nicht auszuschließen, ebenso ein Super-GAU durch Kriegshandlungen; Risiken durch Materialalterung, unvorhergesehenen Materialverschleiß, unsachgemäßen Reparaturen und fehlendes Kühlwasser. Es gibt weltweit kein Endlager für Atommüll, keine Atomanlage sei versichert, ohne Subventionen ist Atomstrom mehr als viermal so teuer wie heutige Windkraftanlagen, das meiste angereicherte Uran kommt aus Russland, die Uranförderung belastet die Umwelt schwer, die deutschen Atomkraftwerke müssen auch heute nur den technischen Stand von 1980 nachweisen. Um die Strompreise zu senken fordert die Fraktion, Übertragungsnetze zu verstaatlichen und ein preiswertes Grundkontingent an Strom für Haushalte, Landwirtschaft und Handwerk einzuführen. Das größte Risiko für die Stromversorgung gehe von Spekulationen mit Strom und von veralteten und falschen Strommarktregeln aus, so der Abgeordnete.
Für den SPD-Abgeordneten Carsten Träger sei die beschlossene Gesetzesänderung nur notwendig, da „das Gas als Rückgrat unserer Energieversorgung innerhalb weniger Monate komplett ausgefallen“ sei. Der verschobene Ausstieg sei „unwiderruflich, endgültig – es bleibt beim Ausstieg aus der Atomenergie“, so der Fürther Abgeordnete. Der FDP-Abgeordnete Lukas Köhler argumentierte, dass für den Winter 2023/2024 die Energieversorgung mithilfe der dann ausgebauten LNG-Infrastruktur und mit Kohle sichergestellt werden könne. Eine andere FDP-Abgeordnete, Carina Konrad, argumentierte jedoch für den Einsatz von Fracking.
Wie die DGS-News bereits berichteten, bleibt ein Argument bei der Debatte auch entscheidend: Die träge reagierenden AKWs passen nicht zu einem Stromsystem mit einem Anteil von rund 50 % Erneuerbaren Energien.
Dieses Argument brachte auch Claudia Kemfert bei der öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz ein: „Vor allem aber blockierten längere Laufzeiten den dringend nötigen Ausbau der Erneuerbaren Energien.“ Denn diese ergänzen sich „mit Speichertechnologien, Demand-Side-Management und flexiblen Backup-Kapazitäten – aber eben nicht mit unflexiblen Atomkraftwerken“, so die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).
Viele Umweltverbände haben die Gesetzesänderung kritisiert. Julian Bothe von der Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt fordert, dass die Bundesregierung „den Stromexport ins Ausland auf die physikalisch transportierbaren Mengen beschränken“ soll, etwa mittels der EU-Elektrizitätsbinnenmarktverordnung, um so die Netzstabilität zu erhöhen. Der Stresstest zeigt seiner Meinung nach: „die kritischen Situationen für das Stromnetz, vor denen die Netzbetreiber warnen, sind solche, in denen zu viel (!) Strom im Angebot ist“. Am Markt werde dann mehr Strom ins Ausland verkauft, als Leitungen vorhanden seien.
Was der Streckbetrieb auch bedeutet: Keine PSÜ
Die Gesetzesänderung ermöglicht einen Streckbetrieb ohne eine große, alle zehn Jahre durchzuführende periodische Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) – auf die bereits 2019 verzichtet wurde. Anders gesagt: „Für die drei Kraftwerke erfolgte die letzte PSÜ aber schon 2009“, wie das ZDF berichtet. Diese Situation kritisiert auch Angelika Claußen, Vorstandsvorsitzende der Internationalen Ärzt*innen zur Verhütung des Atomkrieges (IPPNW). Ihrer Meinung nach würde ein Weiterbetrieb der deutschen AKW über das Jahresende 2022 hinaus und der erneute Ausfall der PSÜ das Risiko eines Atomunfalls enorm vergrößern. „Darüber hinaus verlängert ein Weiterbetrieb der AKW die gesundheitlichen Gefahren, die die ionisierende Strahlung schon im ,Normalbetrieb‘ für die Bevölkerung und die Beschäftigten mit sich bringt“, ergänzt die Ärztin. „Kinder, die im Umkreis von AKW aufwachsen, haben nachweislich ein erhöhtes Krebsrisiko“, warnt Claußen.
Bundesrat entscheidet am 25. November
Der Bundesrat muss der Gesetzesänderung noch zustimmen. Die Sitzung ist für den 25. November geplant. „Dass die Ländervertretung die Pläne noch zu Fall bringt, ist aber sehr unwahrscheinlich“, berichtet die Tagesschau.